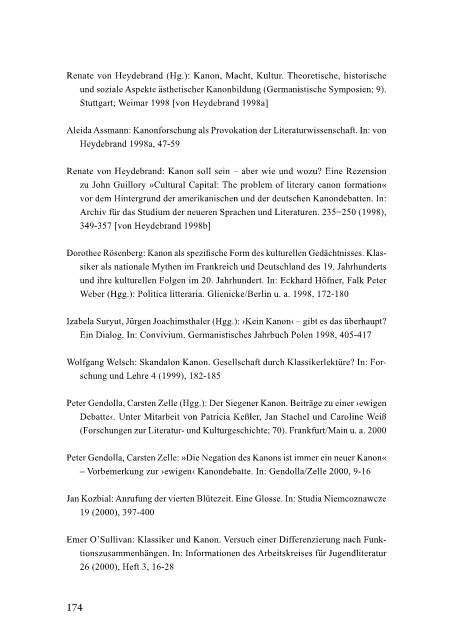Page 178 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 178
Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon, Macht, Kultur. Theoretische, historische
und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung (Germanistische Symposien; 9).
Stuttgart; Weimar 1998 [von Heydebrand 1998a]
Aleida Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft. In: von
Heydebrand 1998a, 47-59
Renate von Heydebrand: Kanon soll sein – aber wie und wozu? Eine Rezension
zu John Guillory »Cultural Capital: The problem of literary ca non formation«
vor dem Hintergrund der amerikanischen und der deutschen Kanondebatten. In:
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera turen. 235=250 (1998),
349-357 [von Heydebrand 1998b]
Dorothee Rösenberg: Kanon als spezifische Form des kulturellen Gedächtnis ses. Klas-
siker als nationale Mythen im Frankreich und Deutschland des 19. Jahrhunderts
und ihre kulturellen Folgen im 20. Jahrhundert. In: Eckhard Höfner, Falk Peter
Weber (Hgg.): Politica litteraria. Glienicke/Berlin u. a. 1998, 172-180
Izabela Suryut, Jürgen Joachimsthaler (Hgg.): ›Kein Kanon‹ – gibt es das überhaupt?
Ein Dialog. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1998, 405-417
Wolfgang Welsch: Skandalon Kanon. Gesellschaft durch Klassikerlektüre? In: For-
schung und Lehre 4 (1999), 182-185
Peter Gendolla, Carsten Zelle (Hgg.): Der Siegener Kanon. Beiträge zu einer ›ewigen
Debatte‹. Unter Mitarbeit von Patricia Keßler, Jan Stachel und Caroline Weiß
(Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte; 70). Frankfurt/Main u. a. 2000
Peter Gendolla, Carsten Zelle: »Die Negation des Kanons ist immer ein neuer Kanon«
– Vorbemerkung zur ›ewigen‹ Kanondebatte. In: Gendolla/Zelle 2000, 9-16
Jan Kozbial: Anrufung der vierten Blütezeit. Eine Glosse. In: Studia Niemcoznawcze
19 (2000), 397-400
Emer O’Sullivan: Klassiker und Kanon. Versuch einer Differenzierung nach Funk-
tionszusammenhängen. In: Informationen des Arbeitskreises für Jugend literatur
26 (2000), Heft 3, 16-28
174