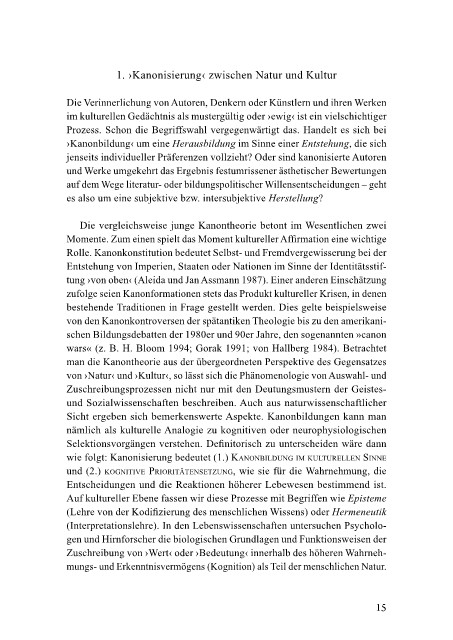Page 19 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 19
1. ›Kanonisierung‹ zwischen Natur und Kultur
Die Verinnerlichung von Autoren, Denkern oder Künstlern und ihren Werken
im kulturellen Gedächtnis als mustergültig oder ›ewig‹ ist ein vielschichtiger
Prozess. Schon die Begriffswahl vergegenwärtigt das. Handelt es sich bei
›Kanonbildung‹ um eine Herausbildung im Sinne einer Entstehung, die sich
jenseits individueller Präferenzen vollzieht? Oder sind kanonisierte Autoren
und Werke umgekehrt das Ergebnis festumrissener ästhetischer Bewertungen
auf dem Wege literatur- oder bildungspolitischer Willensentscheidungen – geht
es also um eine subjektive bzw. intersubjektive Herstellung?
Die vergleichsweise junge Kanontheorie betont im Wesentlichen zwei
Momente. Zum einen spielt das Moment kultureller Affirmation eine wichtige
Rolle. Kanonkonstitution bedeutet Selbst- und Fremdvergewisserung bei der
Entstehung von Imperien, Staaten oder Nationen im Sinne der Identitätsstif-
tung ›von oben‹ (Aleida und Jan Assmann 1987). Einer anderen Einschätzung
zufolge seien Kanonformationen stets das Produkt kultureller Krisen, in denen
bestehende Traditionen in Frage gestellt werden. Dies gelte beispielsweise
von den Kanonkontroversen der spätantiken Theologie bis zu den amerikani-
schen Bildungsdebatten der 1980er und 90er Jahre, den sogenannten »canon
wars« (z. B. H. Bloom 1994; Gorak 1991; von Hallberg 1984). Betrachtet
man die Kanontheorie aus der übergeordneten Perspektive des Gegensatzes
von ›Natur‹ und ›Kultur‹, so lässt sich die Phänomenologie von Auswahl- und
Zuschreibungsprozessen nicht nur mit den Deutungsmustern der Geistes-
und Sozialwissenschaften beschreiben. Auch aus naturwissenschaftlicher
Sicht ergeben sich bemerkenswerte Aspekte. Kanonbildungen kann man
nämlich als kulturelle Analogie zu kognitiven oder neurophysiologischen
Selektionsvorgängen verstehen. Definitorisch zu unterscheiden wäre dann
wie folgt: Kanonisierung bedeutet (1.) KanonBIldung Im KulturEllEn sInnE
und (2.) KognItIvE PrIorItätEnsEtzung, wie sie für die Wahrnehmung, die
Entscheidungen und die Reaktionen höherer Lebewesen bestimmend ist.
Auf kultureller Ebene fassen wir diese Prozesse mit Begriffen wie Episteme
(Lehre von der Kodifizierung des menschlichen Wissens) oder Hermeneutik
(Interpretationslehre). In den Lebenswissenschaften untersuchen Psycholo-
gen und Hirnforscher die biologischen Grundlagen und Funktionsweisen der
Zuschreibung von ›Wert‹ oder ›Bedeutung‹ innerhalb des höheren Wahrneh-
mungs- und Erkenntnisvermögens (Kognition) als Teil der menschlichen Natur.
15