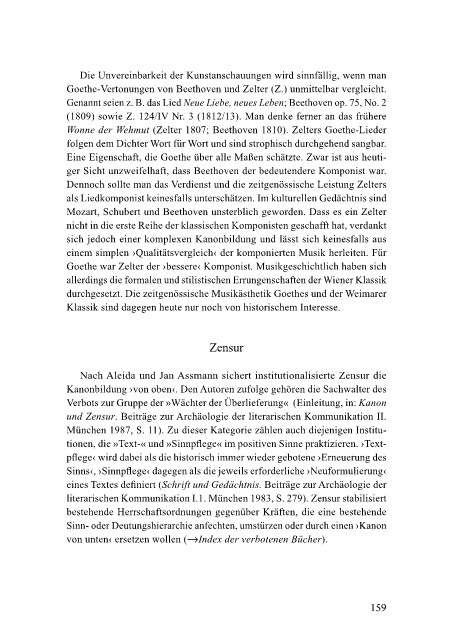Page 163 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 163
Die Unvereinbarkeit der Kunstanschauungen wird sinnfällig, wenn man
Goethe-Vertonungen von Beethoven und Zelter (Z.) unmittelbar vergleicht.
Genannt seien z. B. das Lied Neue Liebe, neues Leben; Beethoven op. 75, No. 2
(1809) sowie Z. 124/IV Nr. 3 (1812/13). Man denke ferner an das frühere
Wonne der Wehmut (Zelter 1807; Beethoven 1810). Zelters Goethe-Lieder
folgen dem Dichter Wort für Wort und sind stro phisch durchgehend sangbar.
Eine Eigenschaft, die Goethe über alle Maßen schätzte. Zwar ist aus heuti-
ger Sicht unzweifelhaft, dass Beethoven der bedeutendere Komponist war.
Dennoch sollte man das Verdienst und die zeit genössische Leistung Zelters
als Liedkomponist keinesfalls unterschätzen. Im kulturellen Gedächtnis sind
Mozart, Schubert und Beethoven unsterblich ge worden. Dass es ein Zelter
nicht in die erste Reihe der klassischen Kom ponisten geschafft hat, verdankt
sich jedoch einer komplexen Kanonbildung und lässt sich keinesfalls aus
einem simplen ›Qualitätsvergleich‹ der kompo nierten Musik herleiten. Für
Goethe war Zelter der ›bessere‹ Komponist. Musik geschichtlich haben sich
allerdings die formalen und stilistischen Errungen schaften der Wiener Klassik
durchgesetzt. Die zeitgenössische Musik ästhetik Goethes und der Weimarer
Klassik sind dagegen heute nur noch von historischem Interesse.
Zensur
Nach Aleida und Jan Assmann sichert institutionalisierte Zensur die
Kanonbildung ›von oben‹. Den Autoren zufolge gehören die Sachwalter des
Verbots zur Gruppe der »Wächter der Überlieferung« (Einleitung, in: Kanon
und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II.
München 1987, S. 11). Zu dieser Kategorie zählen auch diejenigen Institu-
tionen, die »Text-« und »Sinnpflege« im positiven Sinne praktizieren. ›Text-
pflege‹ wird dabei als die historisch immer wieder gebotene ›Erneuerung des
Sinns‹, ›Sinnpflege‹ dagegen als die jeweils erforderliche ›Neuformulierung‹
eines Textes definiert (Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der
literarischen Kommunikation I.1. München 1983, S. 279). Zensur stabilisiert
bestehende Herrschaftsordnungen gegenüber Kräften, die eine bestehende
Sinn- oder Deutungshierarchie anfechten, umstürzen oder durch einen ›Kanon
von unten‹ ersetzen wollen (→Index der verbotenen Bücher).
159