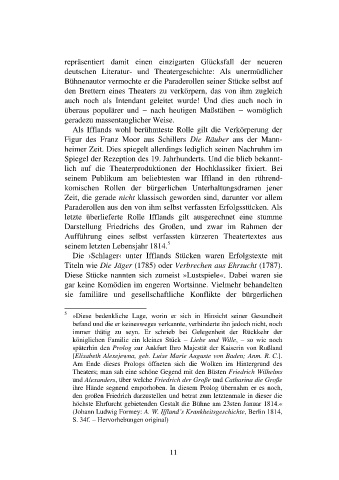Page 13 - Robert Charlier: Goethe und August Wilhelm Iffland (1779-1814)
P. 13
repräsentiert damit einen einzigarten Glücksfall der neueren
deutschen Literatur- und Theatergeschichte: Als unermüdlicher
Bühnenautor vermochte er die Paraderollen seiner Stücke selbst auf
den Brettern eines Theaters zu verkörpern, das von ihm zugleich
auch noch als Intendant geleitet wurde! Und dies auch noch in
überaus populärer und nach heutigen Maßstäben womöglich
geradezu massentauglicher Weise.
Als Ifflands wohl berühmteste Rolle gilt die Verkörperung der
Figur des Franz Moor aus Schillers Die Räuber aus der Mann-
heimer Zeit. Dies spiegelt allerdings lediglich seinen Nachruhm im
Spiegel der Rezeption des 19. Jahrhunderts. Und die blieb bekannt-
lich auf die Theaterproduktionen der Hochklassiker fixiert. Bei
seinem Publikum am beliebtesten war Iffland in den rührend-
komischen Rollen der bürgerlichen Unterhaltungsdramen jener
Zeit, die gerade nicht klassisch geworden sind, darunter vor allem
Paraderollen aus den von ihm selbst verfassten Erfolgsstücken. Als
letzte überlieferte Rolle Ifflands gilt ausgerechnet eine stumme
Darstellung Friedrichs des Großen, und zwar im Rahmen der
Aufführung eines selbst verfassten kürzeren Theatertextes aus
5
seinem letzten Lebensjahr 1814.
Die ›Schlager‹ unter Ifflands Stücken waren Erfolgstexte mit
Titeln wie Die Jäger (1785) oder Verbrechen aus Ehrsucht (1787).
Diese Stücke nannten sich zumeist »Lustspiele«. Dabei waren sie
gar keine Komödien im engeren Wortsinne. Vielmehr behandelten
sie familiäre und gesellschaftliche Konflikte der bürgerlichen
5
»Diese bedenkliche Lage, worin er sich in Hinsicht seiner Gesundheit
befand und die er keinesweges verkannte, verhinderte ihn jedoch nicht, noch
immer thätig zu seyn. Er schrieb bei Gelegenheit der Rückkehr der
königlichen Familie ein kleines Stück ‒ Liebe und Wille, ‒ so wie noch
späterhin den Prolog zur Ankfurt Ihro Majestät der Kaiserin von Rußland
[Elisabeth Alexejewna, geb. Luise Marie Auguste von Baden; Anm. R. C.].
Am Ende dieses Prologs öffneten sich die Wolken im Hintergrund des
Theaters; man sah eine schöne Gegend mit den Büsten Friedrich Wilhelms
und Alexanders, über welche Friedrich der Große und Catharina die Große
ihre Hände segnend emporhoben. In diesem Prolog übernahm er es noch,
den großen Friedrich darzustellen und betrat zum letztenmale in dieser die
höchste Ehrfurcht gebietenden Gestalt die Bühne am 23sten Januar 1814.«
(Johann Ludwig Formey: A. W. Ifflandʼs Krankheitsgeschichte, Berlin 1814,
S. 34f. ‒ Hervorhebungen original)
11