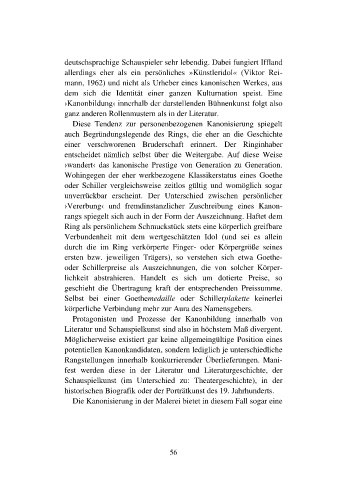Page 58 - Robert Charlier: Goethe und August Wilhelm Iffland (1779-1814)
P. 58
deutschsprachige Schauspieler sehr lebendig. Dabei fungiert Iffland
allerdings eher als ein persönliches »Künstleridol« (Viktor Rei-
mann, 1962) und nicht als Urheber eines kanonischen Werkes, aus
dem sich die Identität einer ganzen Kulturnation speist. Eine
›Kanonbildung‹ innerhalb der darstellenden Bühnenkunst folgt also
ganz anderen Rollenmustern als in der Literatur.
Diese Tendenz zur personenbezogenen Kanonisierung spiegelt
auch Begründungslegende des Rings, die eher an die Geschichte
einer verschworenen Bruderschaft erinnert. Der Ringinhaber
entscheidet nämlich selbst über die Weitergabe. Auf diese Weise
›wandert‹ das kanonische Prestige von Generation zu Generation.
Wohingegen der eher werkbezogene Klassikerstatus eines Goethe
oder Schiller vergleichsweise zeitlos gültig und womöglich sogar
unverrückbar erscheint. Der Unterschied zwischen persönlicher
›Vererbung‹ und fremdinstanzlicher Zuschreibung eines Kanon-
rangs spiegelt sich auch in der Form der Auszeichnung. Haftet dem
Ring als persönlichem Schmuckstück stets eine körperlich greifbare
Verbundenheit mit dem wertgeschätzten Idol (und sei es allein
durch die im Ring verkörperte Finger- oder Körpergröße seines
ersten bzw. jeweiligen Trägers), so verstehen sich etwa Goethe-
oder Schillerpreise als Auszeichnungen, die von solcher Körper-
lichkeit abstrahieren. Handelt es sich um dotierte Preise, so
geschieht die Übertragung kraft der entsprechenden Preissumme.
Selbst bei einer Goethemedaille oder Schillerplakette keinerlei
körperliche Verbindung mehr zur Aura des Namensgebers.
Protagonisten und Prozesse der Kanonbildung innerhalb von
Literatur und Schauspielkunst sind also in höchstem Maß divergent.
Möglicherweise existiert gar keine allgemeingültige Position eines
potentiellen Kanonkandidaten, sondern lediglich je unterschiedliche
Rangstellungen innerhalb konkurrierender Überlieferungen. Mani-
fest werden diese in der Literatur und Literaturgeschichte, der
Schauspielkunst (im Unterschied zu: Theatergeschichte), in der
historischen Biografik oder der Porträtkunst des 19. Jahrhunderts.
Die Kanonisierung in der Malerei bietet in diesem Fall sogar eine
56