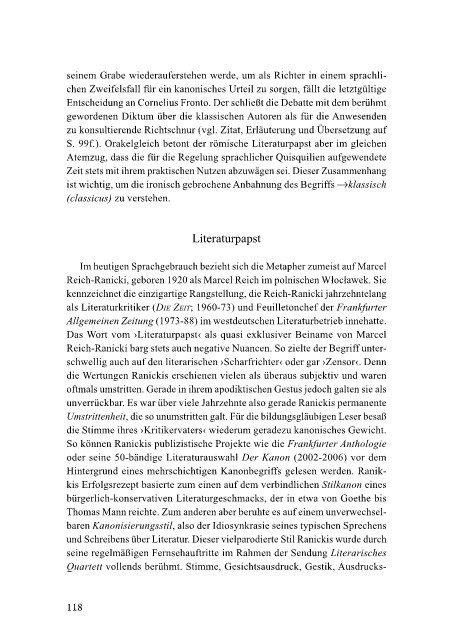Page 122 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 122
seinem Grabe wiederauferstehen werde, um als Richter in einem sprachli-
chen Zweifelsfall für ein kanonisches Urteil zu sorgen, fällt die letztgültige
Entscheidung an Cornelius Fronto. Der schließt die Debatte mit dem berühmt
gewordenen Diktum über die klassischen Autoren als für die Anwesenden
zu konsultierende Richtschnur (vgl. Zitat, Erläuterung und Übersetzung auf
S. 99f.). Orakelgleich betont der römische Literaturpapst aber im gleichen
Atemzug, dass die für die Regelung sprachlicher Quisquilien aufgewendete
Zeit stets mit ihrem praktischen Nutzen abzuwägen sei. Dieser Zusammenhang
ist wichtig, um die ironisch gebrochene Anbahnung des Begriffs →klassisch
(classicus) zu verstehen.
Literaturpapst
Im heutigen Sprachgebrauch bezieht sich die Metapher zumeist auf Marcel
Reich-Ranicki, geboren 1920 als Marcel Reich im polnischen Włocławek. Sie
kennzeichnet die einzigartige Rangstellung, die Reich-Ranicki jahrzehntelang
als Literaturkritiker (Die Zeit; 1960-73) und Feuilletonchef der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (1973-88) im westdeutschen Literaturbetrieb innehatte.
Das Wort vom ›Literaturpapst‹ als quasi exklusiver Beiname von Marcel
Reich-Ranicki barg stets auch negative Nuancen. So zielte der Begriff unter-
schwellig auch auf den literarischen ›Scharfrichter‹ oder gar ›Zensor‹. Denn
die Wertungen Ranickis erschienen vielen als überaus subjektiv und waren
oftmals um stritten. Gerade in ihrem apodiktischen Gestus jedoch galten sie als
unverrück bar. Es war über viele Jahrzehnte also gerade Ranickis permanente
Umstrittenheit, die so unumstritten galt. Für die bildungsgläubigen Leser besaß
die Stimme ihres ›Kritikervaters‹ wiederum geradezu kanonisches Gewicht.
So können Ranickis publizistische Projekte wie die Frankfurter Anthologie
oder seine 50-bändige Literaturauswahl Der Kanon (2002-2006) vor dem
Hintergrund eines mehrschichtigen Kanonbegriffs gelesen werden. Ranik-
kis Erfolgsrezept basierte zum einen auf dem verbindlichen Stilkanon eines
bürgerlich-konservativen Literaturgeschmacks, der in etwa von Goethe bis
Thomas Mann reichte. Zum anderen aber beruhte es auf einem unverwechsel-
baren Kanonisierungsstil, also der Idio synkrasie seines typischen Sprechens
und Schreibens über Literatur. Dieser vielparodierte Stil Ranickis wurde durch
seine regelmäßigen Fernsehauftritte im Rahmen der Sendung Literarisches
Quartett vollends berühmt. Stimme, Gesichtsausdruck, Gestik, Ausdrucks-
118