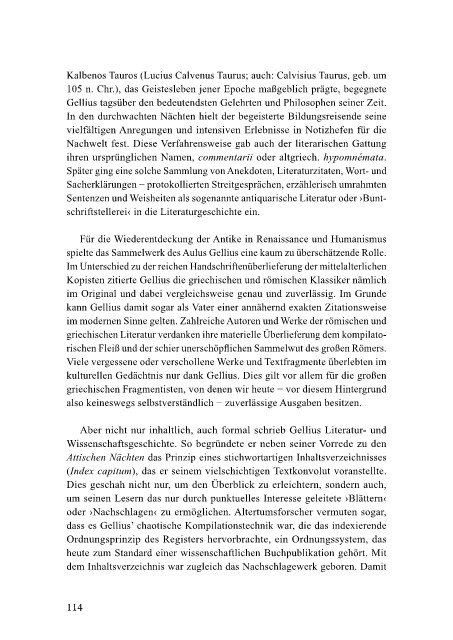Page 118 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 118
Kalbenos Tauros (Lucius Calvenus Taurus; auch: Calvisius Taurus, geb. um
105 n. Chr.), das Geistesleben jener Epoche maßgeblich prägte, begegnete
Gellius tagsüber den bedeutendsten Gelehrten und Philosophen seiner Zeit.
In den durchwachten Nächten hielt der begeisterte Bildungsreisende seine
vielfältigen Anregungen und intensiven Erlebnisse in Notizhefen für die
Nachwelt fest. Diese Verfahrensweise gab auch der literarischen Gattung
ihren ursprünglichen Namen, commentarii oder altgriech. hypomnémata.
Später ging eine solche Sammlung von Anekdoten, Literaturzitaten, Wort- und
Sacherklärungen − protokollierten Streitgesprächen, erzählerisch umrahmten
Sentenzen und Weisheiten als sogenannte antiquarische Literatur oder ›Bunt-
schriftstellerei‹ in die Literaturgeschichte ein.
Für die Wiederentdeckung der Antike in Renaissance und Humanismus
spielte das Sammelwerk des Aulus Gellius eine kaum zu überschätzende Rolle.
Im Unterschied zu der reichen Handschriftenüberlieferung der mittelalterlichen
Kopisten zitierte Gellius die griechischen und römischen Klassiker nämlich
im Original und dabei vergleichsweise genau und zuverlässig. Im Grunde
kann Gellius damit sogar als Vater einer annähernd exakten Zitationsweise
im modernen Sinne gelten. Zahlreiche Autoren und Werke der römischen und
griechischen Literatur verdanken ihre materielle Überlieferung dem kompilato-
rischen Fleiß und der schier unerschöpflichen Sammelwut des großen Römers.
Viele vergessene oder verschollene Werke und Textfragmente überlebten im
kulturellen Gedächtnis nur dank Gellius. Dies gilt vor allem für die großen
griechischen Fragmentisten, von denen wir heute − vor diesem Hintergrund
also keineswegs selbstverständlich − zuverlässige Ausgaben besitzen.
Aber nicht nur inhaltlich, auch formal schrieb Gellius Literatur- und
Wissenschaftsgeschichte. So begründete er neben seiner Vorrede zu den
Attischen Nächten das Prinzip eines stichwortartigen Inhaltsverzeichnisses
(Index capitum), das er seinem vielschichtigen Textkonvolut voranstellte.
Dies geschah nicht nur, um den Überblick zu erleichtern, sondern auch,
um seinen Lesern das nur durch punktuelles Interesse geleitete ›Blättern‹
oder ›Nachschlagen‹ zu ermöglichen. Altertumsforscher vermuten sogar,
dass es Gellius’ chaotische Kompilationstechnik war, die das indexierende
Ordnungsprinzip des Registers hervorbrachte, ein Ordnungssystem, das
heute zum Standard einer wissenschaftlichen Buchpublikation gehört. Mit
dem Inhaltsverzeichnis war zugleich das Nachschlagewerk geboren. Damit
114