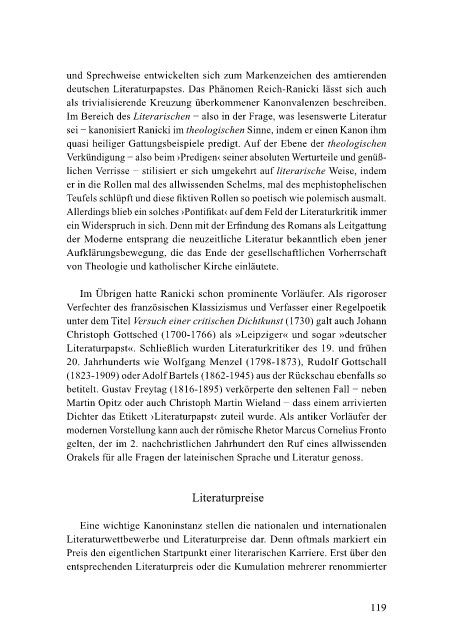Page 123 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 123
und Sprechweise entwickelten sich zum Marken zeichen des amtierenden
deutschen Literaturpapstes. Das Phänomen Reich-Ranicki lässt sich auch
als trivialisierende Kreuzung überkommener Kanon valenzen beschreiben.
Im Bereich des Literarischen − also in der Frage, was lesenswerte Literatur
sei − kanonisiert Ranicki im theologischen Sinne, indem er einen Kanon ihm
quasi heiliger Gattungsbeispiele predigt. Auf der Ebene der theologischen
Verkündigung − also beim ›Predigen‹ seiner absoluten Wert urteile und genüß-
lichen Verrisse − stilisiert er sich umgekehrt auf literarische Weise, indem
er in die Rollen mal des allwissenden Schelms, mal des mephistophelischen
Teufels schlüpft und diese fiktiven Rollen so poetisch wie polemisch ausmalt.
Allerdings blieb ein solches ›Pontifikat‹ auf dem Feld der Literatur kritik immer
ein Widerspruch in sich. Denn mit der Erfindung des Romans als Leitgattung
der Moderne entsprang die neuzeitliche Literatur bekanntlich eben jener
Aufklärungsbewegung, die das Ende der gesellschaftlichen Vorherrschaft
von Theologie und katholischer Kirche einläutete.
Im Übrigen hatte Ranicki schon prominente Vorläufer. Als rigoroser
Ver fechter des französischen Klassizismus und Verfasser einer Regelpoetik
unter dem Titel Versuch einer critischen Dichtkunst (1730) galt auch Johann
Christoph Gottsched (1700-1766) als »Leipziger« und sogar »deutscher
Literatur papst«. Schließlich wurden Literaturkritiker des 19. und frühen
20. Jahrhunderts wie Wolfgang Menzel (1798-1873), Rudolf Gottschall
(1823-1909) oder Adolf Bartels (1862-1945) aus der Rückschau ebenfalls so
betitelt. Gustav Freytag (1816-1895) verkörperte den seltenen Fall − neben
Martin Opitz oder auch Christoph Martin Wieland − dass einem arrivierten
Dichter das Etikett ›Literaturpapst‹ zuteil wurde. Als antiker Vorläufer der
modernen Vorstellung kann auch der römische Rhetor Marcus Cornelius Fronto
gelten, der im 2. nachchristlichen Jahrhundert den Ruf eines allwissenden
Orakels für alle Fragen der lateinischen Sprache und Literatur genoss.
Literaturpreise
Eine wichtige Kanoninstanz stellen die nationalen und internationalen
Literatur wettbewerbe und Literaturpreise dar. Denn oftmals markiert ein
Preis den eigentlichen Startpunkt einer literarischen Karriere. Erst über den
entsprechenden Literaturpreis oder die Kumulation mehrerer renommierter
119