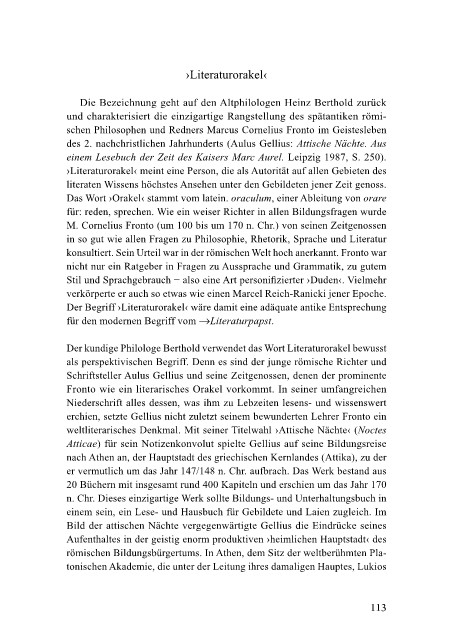Page 117 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 117
›Literaturorakel‹
Die Bezeichnung geht auf den Altphilologen Heinz Berthold zurück
und charakterisiert die einzigartige Rangstellung des spätantiken römi-
schen Philosophen und Redners Marcus Cornelius Fronto im Geistesleben
des 2. nachchristlichen Jahrhunderts (Aulus Gellius: Attische Nächte. Aus
einem Lesebuch der Zeit des Kaisers Marc Aurel. Leipzig 1987, S. 250).
›Literaturorakel‹ meint eine Person, die als Autorität auf allen Gebieten des
literaten Wissens höchstes Ansehen unter den Gebildeten jener Zeit genoss.
Das Wort ›Orakel‹ stammt vom latein. oraculum, einer Ableitung von orare
für: reden, sprechen. Wie ein weiser Richter in allen Bildungsfragen wurde
M. Cornelius Fronto (um 100 bis um 170 n. Chr.) von seinen Zeitgenossen
in so gut wie allen Fragen zu Philosophie, Rhetorik, Sprache und Literatur
konsultiert. Sein Urteil war in der römischen Welt hoch anerkannt. Fronto war
nicht nur ein Ratgeber in Fragen zu Aussprache und Grammatik, zu gutem
Stil und Sprachgebrauch − also eine Art personifizierter ›Duden‹. Vielmehr
verkörperte er auch so etwas wie einen Marcel Reich-Ranicki jener Epoche.
Der Begriff ›Literaturorakel‹ wäre damit eine adäquate antike Entsprechung
für den modernen Begriff vom →Literaturpapst.
Der kundige Philologe Berthold verwendet das Wort Literaturorakel bewusst
als perspektivischen Begriff. Denn es sind der junge römische Richter und
Schriftsteller Aulus Gellius und seine Zeitgenossen, denen der prominente
Fronto wie ein literarisches Orakel vorkommt. In seiner umfangreichen
Niederschrift alles dessen, was ihm zu Lebzeiten lesens- und wissenswert
erchien, setzte Gellius nicht zuletzt seinem bewunderten Lehrer Fronto ein
weltliterarisches Denkmal. Mit seiner Titelwahl ›Attische Nächte‹ (Noctes
Atticae) für sein Notizenkonvolut spielte Gellius auf seine Bildungsreise
nach Athen an, der Hauptstadt des griechischen Kernlandes (Attika), zu der
er vermutlich um das Jahr 147/148 n. Chr. aufbrach. Das Werk bestand aus
20 Büchern mit insgesamt rund 400 Kapiteln und erschien um das Jahr 170
n. Chr. Dieses einzigartige Werk sollte Bildungs- und Unterhaltungsbuch in
einem sein, ein Lese- und Hausbuch für Gebildete und Laien zugleich. Im
Bild der attischen Nächte vergegenwärtigte Gellius die Eindrücke seines
Aufenthaltes in der geistig enorm produktiven ›heimlichen Hauptstadt‹ des
römischen Bildungsbürgertums. In Athen, dem Sitz der weltberühmten Pla-
tonischen Akademie, die unter der Leitung ihres damaligen Hauptes, Lukios
113