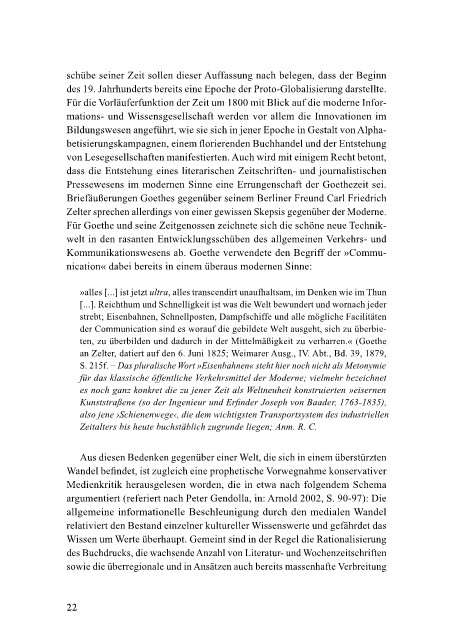Page 26 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 26
schübe seiner Zeit sollen dieser Auffassung nach belegen, dass der Beginn
des 19. Jahrhunderts bereits eine Epoche der Proto-Globalisierung darstellte.
Für die Vorläuferfunktion der Zeit um 1800 mit Blick auf die moderne Infor-
mations- und Wissensgesellschaft werden vor allem die Innovationen im
Bildungswesen angeführt, wie sie sich in jener Epoche in Gestalt von Alpha-
betisierungskampagnen, einem florierenden Buchhandel und der Entstehung
von Lesegesellschaften manifestierten. Auch wird mit einigem Recht betont,
dass die Entstehung eines literarischen Zeitschriften- und journalistischen
Pressewesens im modernen Sinne eine Errungenschaft der Goethezeit sei.
Briefäußerungen Goethes gegenüber seinem Berliner Freund Carl Friedrich
Zelter sprechen allerdings von einer gewissen Skepsis gegenüber der Moderne.
Für Goethe und seine Zeitgenossen zeichnete sich die schöne neue Technik-
welt in den rasanten Entwicklungsschüben des allgemeinen Verkehrs- und
Kommunikationswesens ab. Goethe verwendete den Begriff der »Commu-
nication« dabei bereits in einem überaus modernen Sinne:
»alles [...] ist jetzt ultra, alles transcendirt unaufhaltsam, im Denken wie im Thun
[...]. Reichthum und Schnelligkeit ist was die Welt bewundert und wornach jeder
strebt; Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle mögliche Facilitäten
der Communication sind es worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbie-
ten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren.« (Goethe
an Zelter, datiert auf den 6. Juni 1825; Weimarer Ausg., IV. Abt., Bd. 39, 1879,
S. 215f. − Das pluralische Wort »Eisenbahnen« steht hier noch nicht als Metonymie
für das klassische öffentliche Verkehrsmittel der Moderne; vielmehr bezeichnet
es noch ganz konkret die zu jener Zeit als Weltneuheit konstruierten »eisernen
Kunststraßen« (so der Ingenieur und Erfinder Joseph von Baader , 1763-1835),
also jene ›Schienenwege‹, die dem wichtigsten Transportsystem des industriellen
Zeitalters bis heute buchstäblich zugrunde liegen; Anm. R. C.
Aus diesen Bedenken gegenüber einer Welt, die sich in einem überstürzten
Wandel befindet, ist zugleich eine prophetische Vorwegnahme konservativer
Medienkritik herausgelesen worden, die in etwa nach folgendem Schema
argumentiert (referiert nach Peter Gendolla, in: Arnold 2002, S. 90-97): Die
allgemeine informationelle Beschleunigung durch den medialen Wandel
relativiert den Bestand einzelner kultureller Wissenswerte und gefährdet das
Wissen um Werte überhaupt. Gemeint sind in der Regel die Rationalisierung
des Buchdrucks, die wachsende Anzahl von Literatur- und Wochenzeitschriften
sowie die überregionale und in Ansätzen auch bereits massenhafte Verbreitung
22