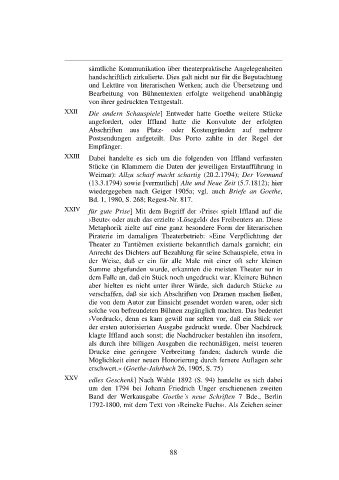Page 90 - Robert Charlier: Goethe und August Wilhelm Iffland (1779-1814)
P. 90
sämtliche Kommunikation über theaterpraktische Angelegenheiten
handschriftlich zirkulierte. Dies galt nicht nur für die Begutachtung
und Lektüre von literarischen Werken; auch die Übersetzung und
Bearbeitung von Bühnentexten erfolgte weitgehend unabhängig
von ihrer gedruckten Textgestalt.
XXII Die andern Schauspiele] Entweder hatte Goethe weitere Stücke
angefordert, oder Iffland hatte die Konvulute der erfolgten
Abschriften aus Platz- oder Kostengründen auf mehrere
Postsendungen aufgeteilt. Das Porto zahlte in der Regel der
Empfänger.
XXIII Dabei handelte es sich um die folgenden von Iffland verfassten
Stücke (in Klammern die Daten der jeweiligen Erstaufführung in
Weimar): Allzu scharf macht schartig (20.2.1794); Der Vormund
(13.3.1794) sowie [vermutlich] Alte und Neue Zeit (5.7.1812); hier
wiedergegeben nach Geiger 1905a; vgl. auch Briefe an Goethe,
Bd. 1, 1980, S. 268; Regest-Nr. 817.
XXIV für gute Prise] Mit dem Begriff der ›Prise‹ spielt Iffland auf die
›Beute‹ oder auch das erzielte ›Lösegeld‹ des Freibeuters an. Diese
Metaphorik zielte auf eine ganz besondere Form der literarischen
Piraterie im damaligen Theaterbetrieb: »Eine Verpflichtung der
Theater zu Tantièmen existierte bekanntlich damals garnicht; ein
Anrecht des Dichters auf Bezahlung für seine Schauspiele, etwa in
der Weise, daß er ein für alle Male mit einer oft sehr kleinen
Summe abgefunden wurde, erkannten die meisten Theater nur in
dem Falle an, daß ein Stück noch ungedruckt war. Kleinere Bühnen
aber hielten es nicht unter ihrer Würde, sich dadurch Stücke zu
verschaffen, daß sie sich Abschriften von Dramen machen ließen,
die von dem Autor zur Einsicht gesendet worden waren, oder sich
solche von befreundeten Bühnen zugänglich machten. Das bedeutet
›Vordruck‹, denn es kam gewiß nur selten vor, daß ein Stück vor
der ersten autorisierten Ausgabe gedruckt wurde. Über Nachdruck
klagte Iffland auch sonst; die Nachdrucker bestahlen ihn insofern,
als durch ihre billigen Ausgaben die rechtmäßigen, meist teueren
Drucke eine geringere Verbreitung fanden; dadurch wurde die
Möglichkeit einer neuen Honorierung durch fernere Auflagen sehr
erschwert.« (Goethe-Jahrbuch 26, 1905, S. 75)
XXV edles Geschenk] Nach Wahle 1892 (S. 94) handelte es sich dabei
um den 1794 bei Johann Friedrich Unger erschienenen zweiten
Band der Werkausgabe Goethe’s neue Schriften 7 Bde., Berlin
1792-1800, mit dem Text von ›Reineke Fuchs‹. Als Zeichen seiner
88