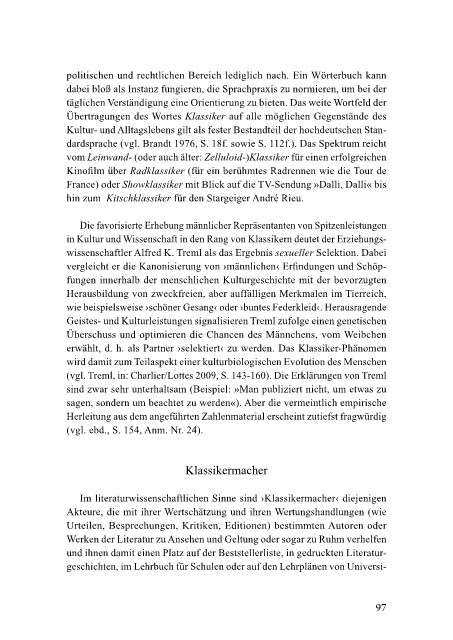Page 101 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 101
politischen und rechtlichen Bereich lediglich nach. Ein Wörterbuch kann
dabei bloß als Instanz fungieren, die Sprachpraxis zu normieren, um bei der
täglichen Ver ständigung eine Orientierung zu bieten. Das weite Wortfeld der
Über tragungen des Wortes Klassiker auf alle möglichen Gegenstände des
Kultur- und Alltagslebens gilt als fester Bestand teil der hochdeutschen Stan-
dardsprache (vgl. Brandt 1976, S. 18f. sowie S. 112f.). Das Spektrum reicht
vom Leinwand- (oder auch älter: Zelluloid-)Klassiker für einen erfolgreichen
Kinofilm über Radklassiker (für ein berühmtes Radrennen wie die Tour de
France) oder Showklassiker mit Blick auf die TV-Sendung »Dalli, Dalli« bis
hin zum Kitschklassiker für den Stargeiger André Rieu.
Die favorisierte Erhebung männlicher Repräsentanten von Spitzen leistungen
in Kultur und Wissenschaft in den Rang von Klassikern deutet der Erziehungs-
wissenschaftler Alfred K. Treml als das Ergebnis sexueller Selektion. Dabei
vergleicht er die Kanonisierung von ›männlichen‹ Erfindungen und Schöp-
fungen innerhalb der menschlichen Kulturgeschichte mit der bevorzugten
Herausbildung von zweckfreien, aber auffälligen Merk malen im Tierreich,
wie beispielsweise ›schöner Gesang‹ oder ›buntes Feder kleid‹. Herausragende
Geistes- und Kulturleistungen signalisieren Treml zu folge einen genetischen
Überschuss und optimieren die Chancen des Männchens, vom Weibchen
erwählt, d. h. als Partner ›selektiert‹ zu werden. Das Klassiker-Phänomen
wird damit zum Teilaspekt einer kulturbiologischen Evolution des Menschen
(vgl. Treml, in: Charlier/Lottes 2009, S. 143-160). Die Erklärungen von Treml
sind zwar sehr unterhaltsam (Beispiel: »Man publiziert nicht, um etwas zu
sagen, sondern um beachtet zu werden«). Aber die vermeintlich empirische
Herleitung aus dem angeführten Zahlenmaterial erscheint zutiefst fragwürdig
(vgl. ebd., S. 154, Anm. Nr. 24).
Klassikermacher
Im literaturwissenschaftlichen Sinne sind ›Klassikermacher‹ diejenigen
Ak teure, die mit ihrer Wertschätzung und ihren Wertungshandlungen (wie
Urteilen, Besprechungen, Kritiken, Editionen) bestimmten Autoren oder
Werken der Literatur zu Ansehen und Geltung oder sogar zu Ruhm verhelfen
und ihnen damit einen Platz auf der Beststellerliste, in gedruckten Literatur-
geschichten, im Lehrbuch für Schulen oder auf den Lehrplänen von Universi-
97