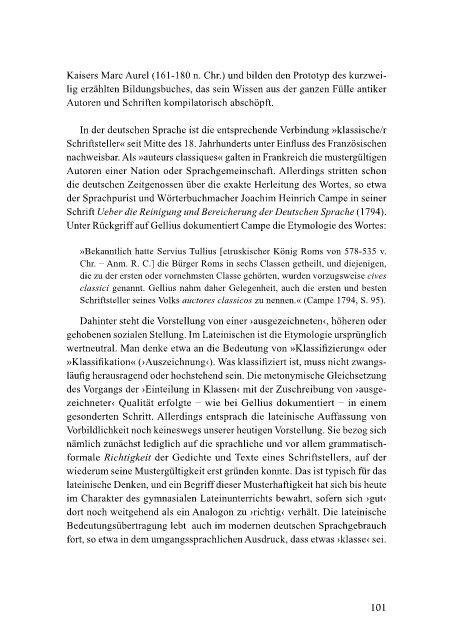Page 105 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 105
Kaisers Marc Aurel (161-180 n. Chr.) und bilden den Prototyp des kurzwei-
lig erzählten Bildungsbuches, das sein Wissen aus der ganzen Fülle antiker
Autoren und Schriften kompilatorisch abschöpft.
In der deutschen Sprache ist die entsprechende Verbindung »klassische/r
Schriftsteller« seit Mitte des 18. Jahrhunderts unter Einfluss des Französischen
nachweisbar. Als »auteurs classiques« galten in Frankreich die mustergültigen
Autoren einer Nation oder Sprachgemeinschaft. Allerdings stritten schon
die deutschen Zeitgenossen über die exakte Herleitung des Wortes, so etwa
der Sprachpurist und Wörterbuchmacher Joachim Heinrich Campe in seiner
Schrift Ueber die Reinigung und Bereicherung der Deutschen Sprache (1794).
Unter Rückgriff auf Gellius dokumentiert Campe die Etymologie des Wortes:
»Bekanntlich hatte Servius Tullius [etruskischer König Roms von 578-535 v.
Chr. − Anm. R. C.] die Bürger Roms in sechs Classen getheilt, und diejenigen,
die zu der ersten oder vornehmsten Classe gehörten, wurden vorzugsweise cives
classici genannt. Gellius nahm daher Gelegenheit, auch die ersten und besten
Schriftsteller seines Volks auctores classicos zu nennen.« (Campe 1794, S. 95).
Dahinter steht die Vorstellung von einer ›ausgezeichneten‹, höheren oder
gehobenen sozialen Stellung. Im Lateinischen ist die Etymologie ursprünglich
wert neutral. Man denke etwa an die Bedeutung von »Klassifizierung« oder
»Klassifikation« (›Auszeichnung‹). Was klassifiziert ist, muss nicht zwangs-
läufig herausragend oder hochstehend sein. Die metonymische Gleichsetzung
des Vorgangs der ›Einteilung in Klassen‹ mit der Zuschreibung von ›ausge-
zeichneter‹ Qualität erfolgte − wie bei Gellius dokumentiert − in einem
gesonderten Schritt. Allerdings entsprach die lateinische Auffassung von
Vorbild lichkeit noch keineswegs unserer heutigen Vorstellung. Sie bezog sich
nämlich zunächst lediglich auf die sprachliche und vor allem grammatisch-
formale Richtigkeit der Gedichte und Texte eines Schriftstellers, auf der
wiederum seine Mustergültigkeit erst gründen konnte. Das ist typisch für das
lateinische Denken, und ein Begriff dieser Musterhaftigkeit hat sich bis heute
im Charak ter des gymnasialen Lateinunterrichts bewahrt, sofern sich ›gut‹
dort noch weitgehend als ein Analogon zu ›richtig‹ verhält. Die lateinische
Bedeutungsübertragung lebt auch im modernen deutschen Sprachgebrauch
fort, so etwa in dem umgangssprachlichen Aus druck, dass etwas ›klasse‹ sei.
101