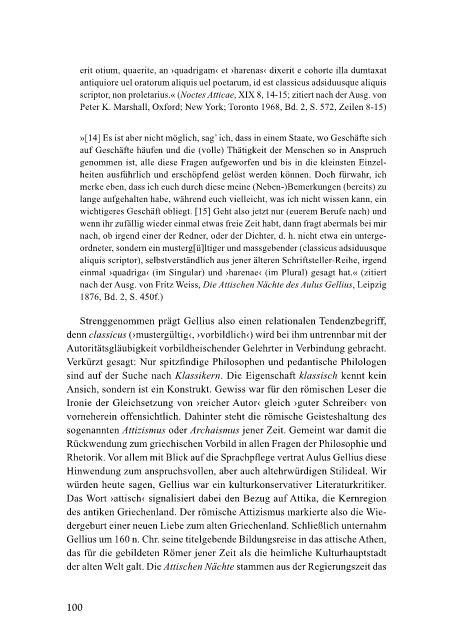Page 104 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 104
erit otium, quaerite, an ›quadrigam‹ et ›harenas‹ dixerit e cohorte illa dumtaxat
antiquiore uel oratorum aliquis uel poetarum, id est classicus adsiduusque aliquis
scriptor, non proletarius.« (Noctes Atticae, XIX 8, 14-15; zitiert nach der Ausg. von
Peter K. Marshall, Oxford; New York; Toronto 1968, Bd. 2, S. 572, Zeilen 8-15)
»[14] Es ist aber nicht möglich, sag’ ich, dass in einem Staate, wo Geschäfte sich
auf Geschäfte häufen und die (volle) Thätigkeit der Menschen so in Anspruch
genommen ist, alle diese Fragen aufgeworfen und bis in die kleinsten Einzel-
heiten ausführlich und erschöpfend gelöst werden können. Doch fürwahr, ich
merke eben, dass ich euch durch diese meine (Neben-)Bemerkungen (bereits) zu
lange aufgehalten habe, während euch vielleicht, was ich nicht wissen kann, ein
wichtigeres Geschäft obliegt. [15] Geht also jetzt nur (euerem Berufe nach) und
wenn ihr zufällig wieder einmal etwas freie Zeit habt, dann fragt abermals bei mir
nach, ob irgend einer der Redner, oder der Dichter, d. h. nicht etwa ein unterge-
ordneter, sondern ein musterg[ü]ltiger und massgebender (classicus adsiduusque
aliquis scriptor), selbstverständlich aus jener älteren Schriftsteller-Reihe, irgend
einmal ›quadriga‹ (im Singular) und ›harenae‹ (im Plural) gesagt hat.« (zitiert
nach der Ausg. von Fritz Weiss, Die Attischen Nächte des Aulus Gellius, Leipzig
1876, Bd. 2, S. 450f.)
Strenggenommen prägt Gellius also einen relationalen Tendenzbegriff,
denn classicus (›mustergültig‹, ›vorbildlich‹) wird bei ihm untrennbar mit der
Autoritätsgläubigkeit vorbildheischender Gelehrter in Verbindung gebracht.
Verkürzt gesagt: Nur spitzfindige Philosophen und pedantische Philologen
sind auf der Suche nach Klassikern. Die Eigenschaft klassisch kennt kein
Ansich, sondern ist ein Konstrukt. Gewiss war für den römischen Leser die
Ironie der Gleichsetzung von ›reicher Autor‹ gleich ›guter Schreiber‹ von
vorneherein offensichtlich. Dahinter steht die römische Geisteshaltung des
sogenannten Attizismus oder Archaismus jener Zeit. Gemeint war damit die
Rückwendung zum griechischen Vorbild in allen Fragen der Philosophie und
Rhetorik. Vor allem mit Blick auf die Sprachpflege vertrat Aulus Gellius diese
Hinwendung zum anspruchsvollen, aber auch altehrwürdigen Stilideal. Wir
würden heute sagen, Gellius war ein kulturkonservativer Literaturkritiker.
Das Wort ›attisch‹ signalisiert dabei den Bezug auf Attika, die Kernregion
des antiken Griechenland. Der römische Attizismus markierte also die Wie-
dergeburt einer neuen Liebe zum alten Griechenland. Schließlich unternahm
Gellius um 160 n. Chr. seine titelgebende Bildungsreise in das attische Athen,
das für die gebildeten Römer jener Zeit als die heimliche Kulturhauptstadt
der alten Welt galt. Die Attischen Nächte stammen aus der Regierungszeit das
100