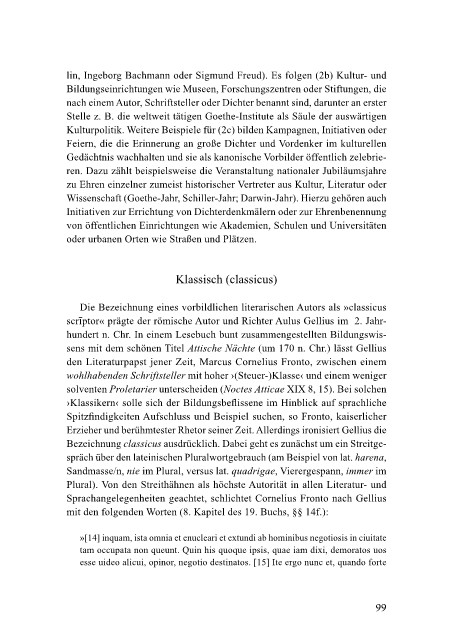Page 103 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 103
lin, Ingeborg Bachmann oder Sigmund Freud). Es folgen (2b) Kultur- und
Bildungs einrichtungen wie Museen, Forschungszentren oder Stiftungen, die
nach einem Autor, Schriftsteller oder Dichter benannt sind, darunter an erster
Stelle z. B. die weltweit tätigen Goethe-Institute als Säule der auswärtigen
Kulturpolitik. Weitere Beispiele für (2c) bilden Kampagnen, Initiativen oder
Feiern, die die Erinnerung an große Dichter und Vordenker im kulturellen
Gedächtnis wachhalten und sie als kanonische Vorbilder öffentlich zelebrie-
ren. Dazu zählt beispielsweise die Veranstaltung nationaler Jubiläums jahre
zu Ehren einzelner zumeist historischer Vertreter aus Kultur, Literatur oder
Wissenschaft (Goethe-Jahr, Schiller-Jahr; Darwin-Jahr). Hierzu gehören auch
Initiativen zur Errichtung von Dichterdenkmälern oder zur Ehrenbenennung
von öffentlichen Einrichtungen wie Akade mien, Schulen und Universitäten
oder urbanen Orten wie Straßen und Plätzen.
Klassisch (classicus)
Die Bezeichnung eines vorbildlichen literarischen Autors als »classicus
scrīptor« prägte der römische Autor und Richter Aulus Gellius im 2. Jahr-
hundert n. Chr. In einem Lesebuch bunt zusammengestellten Bildungswis-
sens mit dem schönen Titel Attische Nächte (um 170 n. Chr.) lässt Gellius
den Literaturpapst jener Zeit, Marcus Cornelius Fronto, zwischen einem
wohlhabenden Schriftsteller mit hoher ›(Steuer-)Klasse‹ und einem weniger
solventen Proletarier unterscheiden (Noctes Atticae XIX 8, 15). Bei solchen
›Klassikern‹ solle sich der Bildungsbeflissene im Hinblick auf sprachliche
Spitzfindigkeiten Aufschluss und Beispiel suchen, so Fronto, kaiserlicher
Erzieher und berühmtester Rhetor seiner Zeit. Allerdings ironisiert Gellius die
Bezeichnung classicus ausdrücklich. Dabei geht es zunächst um ein Streitge-
spräch über den lateinischen Pluralwortgebrauch (am Beispiel von lat. harena,
Sandmasse/n, nie im Plural, versus lat. quadrigae, Vierergespann, immer im
Plural). Von den Streithähnen als höchste Autorität in allen Literatur- und
Sprachangelegenheiten geachtet, schlichtet Cornelius Fronto nach Gellius
mit den folgenden Worten (8. Kapitel des 19. Buchs, §§ 14f.):
»[14] inquam, ista omnia et enucleari et extundi ab hominibus negotiosis in ciuitate
tam occupata non queunt. Quin his quoque ipsis, quae iam dixi, demoratos uos
esse uideo alicui, opinor, negotio destinatos. [15] Ite ergo nunc et, quando forte
99