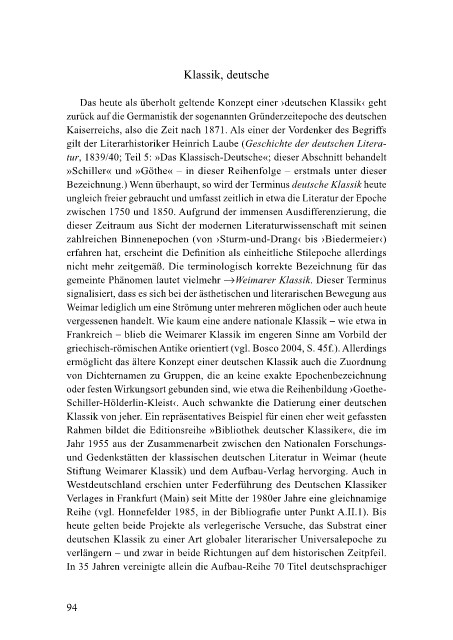Page 98 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 98
Klassik, deutsche
Das heute als überholt geltende Konzept einer ›deutschen Klassik‹ geht
zurück auf die Germanistik der sogenannten Gründerzeitepoche des deutschen
Kaiserreichs, also die Zeit nach 1871. Als einer der Vordenker des Begriffs
gilt der Literarhistoriker Heinrich Laube (Geschichte der deutschen Litera-
tur, 1839/40; Teil 5: »Das Klassisch-Deutsche«; dieser Abschnitt behandelt
»Schiller« und »Göthe« – in dieser Reihenfolge – erstmals unter dieser
Bezeichnung.) Wenn überhaupt, so wird der Terminus deutsche Klassik heute
ungleich freier gebraucht und umfasst zeitlich in etwa die Literatur der Epoche
zwischen 1750 und 1850. Aufgrund der immensen Ausdifferenzierung, die
dieser Zeitraum aus Sicht der modernen Literaturwissenschaft mit seinen
zahlreichen Binnenepochen (von ›Sturm-und-Drang‹ bis ›Biedermeier‹)
erfahren hat, erscheint die Definition als einheitliche Stilepoche allerdings
nicht mehr zeitgemäß. Die terminologisch korrekte Bezeichnung für das
gemeinte Phänomen lautet vielmehr →Weimarer Klassik. Dieser Terminus
signalisiert, dass es sich bei der ästhetischen und literarischen Bewegung aus
Weimar lediglich um eine Strömung unter mehreren möglichen oder auch heute
vergessenen handelt. Wie kaum eine andere nationale Klassik - wie etwa in
Frankreich - blieb die Weimarer Klassik im engeren Sinne am Vorbild der
griechisch-römischen Antike orientiert (vgl. Bosco 2004, S. 45f.). Allerdings
ermöglicht das ältere Konzept einer deutschen Klassik auch die Zuordnung
von Dichternamen zu Gruppen, die an keine exakte Epochenbezeichnung
oder festen Wirkungsort gebunden sind, wie etwa die Reihenbildung ›Goethe-
Schiller-Hölderlin-Kleist‹. Auch schwankte die Datierung einer deutschen
Klassik von jeher. Ein repräsentatives Beispiel für einen eher weit gefassten
Rahmen bildet die Editionsreihe »Bibliothek deutscher Klassiker«, die im
Jahr 1955 aus der Zusammenarbeit zwischen den Nationalen Forschungs-
und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (heute
Stiftung Weimarer Klassik) und dem Aufbau-Verlag hervorging. Auch in
Westdeutschland erschien unter Federführung des Deutschen Klassiker
Verlages in Frankfurt (Main) seit Mitte der 1980er Jahre eine gleichnamige
Reihe (vgl. Honnefelder 1985, in der Bibliografie unter Punkt A.II.1). Bis
heute gelten beide Projekte als verlegerische Versuche, das Substrat einer
deutschen Klassik zu einer Art globaler literarischer Universalepoche zu
verlängern - und zwar in beide Richtungen auf dem historischen Zeitpfeil.
In 35 Jahren vereinigte allein die Aufbau-Reihe 70 Titel deutschsprachiger
94