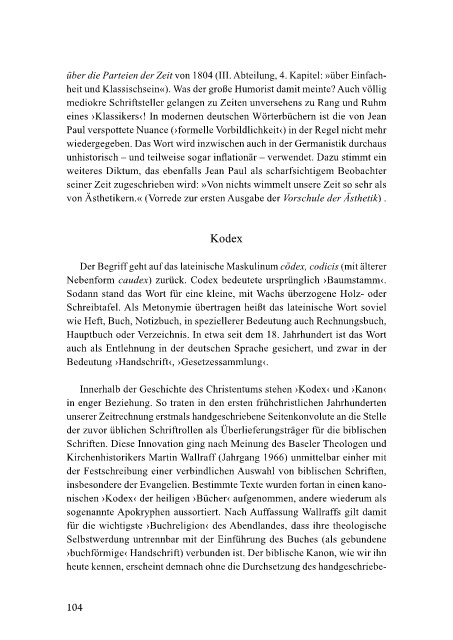Page 108 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 108
über die Parteien der Zeit von 1804 (III. Abteilung, 4. Kapitel: »über Einfach-
heit und Klassischsein«). Was der große Humorist damit meinte? Auch völlig
mediokre Schriftsteller gelangen zu Zeiten unversehens zu Rang und Ruhm
eines ›Klassikers‹! In modernen deutschen Wörterbüchern ist die von Jean
Paul verspottete Nuance (›formelle Vorbildlichkeit‹) in der Regel nicht mehr
wieder gegeben. Das Wort wird inzwischen auch in der Germanistik durchaus
unhistorisch – und teilweise sogar inflationär – verwendet. Dazu stimmt ein
weiteres Diktum, das ebenfalls Jean Paul als scharfsichtigem Beobachter
seiner Zeit zugeschrieben wird: »Von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als
von Ästhetikern.« (Vorrede zur ersten Ausgabe der Vorschule der Ästhetik) .
Kodex
Der Begriff geht auf das lateinische Maskulinum cōdex, codicis (mit älterer
Nebenform caudex) zurück. Codex bedeutete ursprünglich ›Baumstamm‹.
Sodann stand das Wort für eine kleine, mit Wachs überzogene Holz- oder
Schreibtafel. Als Metonymie übertragen heißt das lateinische Wort soviel
wie Heft, Buch, Notizbuch, in speziellerer Bedeutung auch Rechnungs buch,
Hauptbuch oder Verzeichnis. In etwa seit dem 18. Jahrhundert ist das Wort
auch als Entlehnung in der deutschen Sprache gesichert, und zwar in der
Bedeutung ›Handschrift‹, ›Gesetzessammlung‹.
Innerhalb der Geschichte des Christen tums stehen ›Kodex‹ und ›Kanon‹
in enger Beziehung. So traten in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten
unserer Zeitrechnung erstmals hand geschriebene Seitenkonvolute an die Stelle
der zuvor üblichen Schriftrollen als Überlieferungsträger für die biblischen
Schriften. Diese Innovation ging nach Meinung des Baseler Theologen und
Kirchen historikers Martin Wallraff (Jahrgang 1966) unmittelbar einher mit
der Festschreibung einer verbindlichen Auswahl von biblischen Schriften,
insbesondere der Evangelien. Bestimmte Texte wurden fortan in einen kano-
nischen ›Kodex‹ der heiligen ›Bücher‹ aufgenommen, andere wie derum als
sogenannte Apokryphen aussortiert. Nach Auffassung Wallraffs gilt damit
für die wichtigste ›Buchreligion‹ des Abendlandes, dass ihre theo logische
Selbstwerdung untrennbar mit der Einführung des Buches (als gebundene
›buchförmige‹ Handschrift) verbunden ist. Der biblische Kanon, wie wir ihn
heute kennen, erscheint demnach ohne die Durchsetzung des handgeschriebe-
104