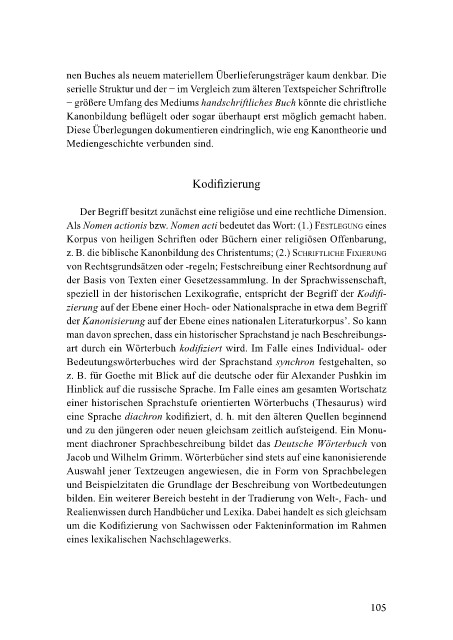Page 109 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 109
nen Buches als neuem materiellem Überlieferungsträger kaum denkbar. Die
serielle Struktur und der − im Vergleich zum älteren Textspeicher Schriftrolle
− größere Um fang des Mediums handschriftliches Buch könnte die christliche
Kanonbildung beflügelt oder sogar überhaupt erst möglich gemacht haben.
Diese Über legungen dokumentieren eindringlich, wie eng Kanontheorie und
Medien geschichte verbunden sind.
Kodifizierung
Der Begriff besitzt zunächst eine religiöse und eine rechtliche Dimension.
Als Nomen actionis bzw. Nomen acti bedeutet das Wort: (1.) fEstlEgung eines
Korpus von heiligen Schriften oder Büchern einer religiösen Offenbarung,
z. B. die biblische Kanonbildung des Christentums; (2.) SchrIftlIchE fIxIErung
von Rechtsgrundsätzen oder -regeln; Festschreibung einer Rechtsordnung auf
der Basis von Texten einer Gesetzessammlung. In der Sprachwissenschaft,
speziell in der historischen Lexikografie, entspricht der Begriff der Kodifi-
zierung auf der Ebene einer Hoch- oder Nationalsprache in etwa dem Begriff
der Kanonisierung auf der Ebene eines nationalen Literaturkorpus’. So kann
man davon sprechen, dass ein historischer Sprachstand je nach Beschreibungs-
art durch ein Wörterbuch kodifiziert wird. Im Falle eines Individual- oder
Bedeutungs wörterbuches wird der Sprachstand synchron festgehalten, so
z. B. für Goethe mit Blick auf die deutsche oder für Alexander Pushkin im
Hinblick auf die russische Sprache. Im Falle eines am gesamten Wortschatz
einer historischen Sprachstufe orientierten Wörterbuchs (Thesaurus) wird
eine Sprache diachron kodifiziert, d. h. mit den älteren Quellen beginnend
und zu den jüngeren oder neuen gleichsam zeitlich aufsteigend. Ein Monu-
ment diachroner Sprachbeschreibung bildet das Deutsche Wörterbuch von
Jacob und Wilhelm Grimm. Wörterbücher sind stets auf eine kanonisierende
Auswahl jener Textzeugen angewiesen, die in Form von Sprachbelegen
und Beispielzitaten die Grundlage der Beschreibung von Wortbedeutungen
bilden. Ein weiterer Bereich besteht in der Tradierung von Welt-, Fach- und
Realienwissen durch Handbücher und Lexika. Dabei handelt es sich gleichsam
um die Kodifizierung von Sachwissen oder Fakteninformation im Rahmen
eines lexikalischen Nachschla gewerks.
105