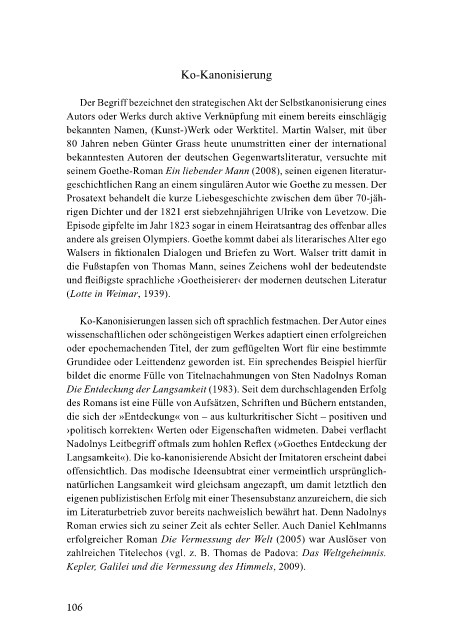Page 110 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 110
Ko-Kanonisierung
Der Begriff bezeichnet den strategischen Akt der Selbstkanonisierung eines
Autors oder Werks durch aktive Verknüpfung mit einem bereits einschlägig
bekannten Namen, (Kunst-)Werk oder Werktitel. Martin Walser, mit über
80 Jahren neben Günter Grass heute unumstritten einer der international
bekann testen Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur, versuchte mit
seinem Goethe-Roman Ein liebender Mann (2008), seinen eigenen literatur-
geschichtlichen Rang an einem singulären Autor wie Goethe zu messen. Der
Prosatext behandelt die kurze Liebesgeschichte zwischen dem über 70-jäh-
rigen Dichter und der 1821 erst siebzehnjährigen Ulrike von Levetzow. Die
Episode gipfelte im Jahr 1823 sogar in einem Heiratsantrag des offenbar alles
andere als greisen Olympiers. Goethe kommt dabei als literarisches Alter ego
Walsers in fiktionalen Dialogen und Briefen zu Wort. Walser tritt damit in
die Fußstapfen von Thomas Mann, seines Zeichens wohl der bedeutendste
und fleißigste sprachliche ›Goetheisierer‹ der modernen deutschen Literatur
(Lotte in Weimar, 1939).
Ko-Kanonisierungen lassen sich oft sprachlich festmachen. Der Autor eines
wissenschaftlichen oder schöngeistigen Werkes adaptiert einen erfolgrei chen
oder epochemachenden Titel, der zum geflügelten Wort für eine be stimmte
Grundidee oder Leittendenz geworden ist. Ein sprechendes Beispiel hierfür
bildet die enorme Fülle von Titelnachahmungen von Sten Nadolnys Roman
Die Entdeckung der Langsamkeit (1983). Seit dem durchschlagenden Erfolg
des Romans ist eine Fülle von Aufsätzen, Schriften und Büchern ent standen,
die sich der »Entdeckung« von – aus kulturkritischer Sicht – positiven und
›politisch korrekten‹ Werten oder Eigenschaften widmeten. Dabei ver flacht
Nadolnys Leitbegriff oftmals zum hohlen Reflex (»Goethes Entdeckung der
Langsamkeit«). Die ko-kanonisierende Absicht der Imitatoren erscheint dabei
offensichtlich. Das modische Ideensubtrat einer vermeintlich ursprünglich-
natürlichen Lang samkeit wird gleichsam angezapft, um damit letztlich den
eigenen publizisti schen Erfolg mit einer Thesensubstanz anzureichern, die sich
im Literatur betrieb zuvor bereits nachweislich bewährt hat. Denn Nadolnys
Roman erwies sich zu seiner Zeit als echter Seller. Auch Daniel Kehlmanns
erfolgreicher Roman Die Vermessung der Welt (2005) war Auslöser von
zahlreichen Titelechos (vgl. z. B. Thomas de Padova: Das Weltgeheimnis.
Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels, 2009).
106