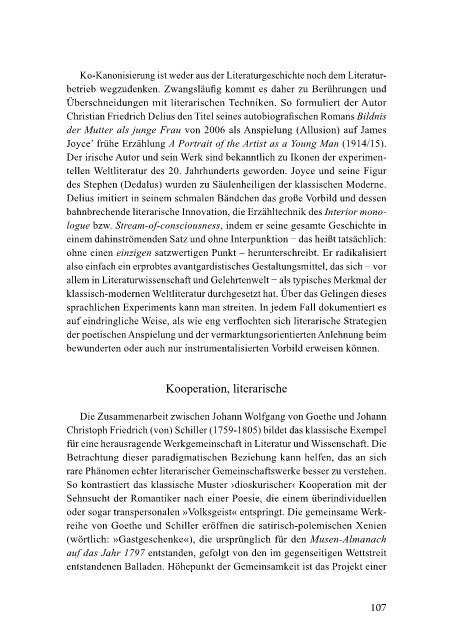Page 111 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 111
Ko-Kanonisierung ist weder aus der Literaturgeschichte noch dem Literatur-
betrieb wegzudenken. Zwangsläufig kommt es daher zu Berührungen und
Überschneidungen mit literarischen Techniken. So formu liert der Autor
Christian Friedrich Delius den Titel seines autobiografischen Romans Bildnis
der Mutter als junge Frau von 2006 als Anspielung (Allusion) auf James
Joyce’ frühe Erzählung A Portrait of the Artist as a Young Man (1914/15).
Der irische Autor und sein Werk sind bekanntlich zu Ikonen der experimen-
tellen Weltliteratur des 20. Jahrhunderts geworden. Joyce und seine Figur
des Stephen (Dedalus) wurden zu Säulenheiligen der klassischen Mo derne.
Delius imitiert in seinem schmalen Bändchen das große Vorbild und dessen
bahnbrechende literarische Innovation, die Erzähltechnik des Interior mono-
logue bzw. Stream-of-consciousness, indem er seine gesamte Ge schichte in
einem dahinströmenden Satz und ohne Interpunktion − das heißt tatsächlich:
ohne einen einzigen satzwertigen Punkt – herunterschreibt. Er radikalisiert
also einfach ein erprobtes avantgardistisches Gestaltungsmittel, das sich − vor
allem in Literaturwissenschaft und Gelehrtenwelt − als typisches Merkmal der
klassisch-modernen Weltliteratur durchgesetzt hat. Über das Gelingen dieses
sprachlichen Experiments kann man streiten. In jedem Fall dokumentiert es
auf eindringliche Weise, als wie eng verflochten sich literarische Strategien
der poetischen Anspielung und der vermarktungsorientierten Anlehnung beim
bewunderten oder auch nur instrumentalisierten Vorbild erweisen können.
Kooperation, literarische
Die Zusammenarbeit zwischen Johann Wolfgang von Goethe und Johann
Christoph Friedrich (von) Schiller (1759-1805) bildet das klassische Exempel
für eine heraus ragende Werkgemeinschaft in Literatur und Wissenschaft. Die
Betrachtung dieser paradigmatischen Beziehung kann helfen, das an sich
rare Phänomen echter literarischer Gemeinschaftswerke besser zu verstehen.
So kontrastiert das klassische Muster ›dioskurischer‹ Kooperation mit der
Sehnsucht der Ro mantiker nach einer Poesie, die einem überindividuellen
oder sogar trans personalen »Volksgeist« entspringt. Die gemeinsame Werk-
reihe von Goethe und Schiller eröffnen die satirisch-polemischen Xenien
(wörtlich: »Gast geschenke«), die ursprünglich für den Musen-Almanach
auf das Jahr 1797 entstanden, gefolgt von den im gegenseitigen Wettstreit
entstandenen Balladen. Höhepunkt der Gemeinsamkeit ist das Projekt einer
107