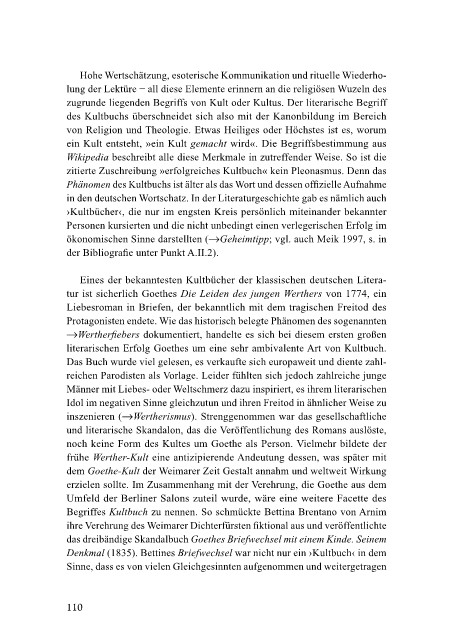Page 114 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 114
Hohe Wertschätzung, esoterische Kommunikation und rituelle Wiederho-
lung der Lektüre − all diese Elemente erinnern an die religiösen Wuzeln des
zugrunde liegenden Begriffs von Kult oder Kultus. Der literarische Begriff
des Kultbuchs überschneidet sich also mit der Kanonbildung im Bereich
von Religion und Theologie. Etwas Heiliges oder Höchstes ist es, worum
ein Kult entsteht, »ein Kult gemacht wird«. Die Begriffsbestimmung aus
Wikipedia beschreibt alle diese Merkmale in zutreffender Weise. So ist die
zitierte Zu schreibung »erfolgreiches Kultbuch« kein Pleonasmus. Denn das
Phänomen des Kultbuchs ist älter als das Wort und dessen offizielle Aufnahme
in den deutschen Wortschatz. In der Literaturgeschichte gab es nämlich auch
›Kult bücher‹, die nur im engsten Kreis persönlich miteinander bekannter
Personen kursierten und die nicht unbedingt einen verlegerischen Erfolg im
öko nomischen Sinne darstellten (→Geheimtipp; vgl. auch Meik 1997, s. in
der Bibliografie unter Punkt A.II.2).
Eines der bekanntesten Kultbücher der klassischen deutschen Litera-
tur ist sicherlich Goethes Die Leiden des jungen Werthers von 1774, ein
Liebesroman in Briefen, der bekanntlich mit dem tra gischen Freitod des
Protagonisten endete. Wie das historisch belegte Phänomen des sogenannten
→Wertherfiebers dokumentiert, handelte es sich bei diesem ersten großen
literarischen Erfolg Goethes um eine sehr ambivalente Art von Kultbuch.
Das Buch wurde viel gelesen, es verkaufte sich europaweit und diente zahl-
reichen Parodisten als Vorlage. Leider fühlten sich jedoch zahlreiche junge
Männer mit Liebes- oder Weltschmerz dazu inspiriert, es ihrem literarischen
Idol im negativen Sinne gleichzutun und ihren Freitod in ähnlicher Weise zu
inszenieren (→Wertherismus). Strenggenommen war das gesellschaftliche
und literarische Skandalon, das die Veröffentlichung des Romans auslöste,
noch keine Form des Kultes um Goethe als Person. Vielmehr bildete der
frühe Werther-Kult eine antizipierende Andeutung dessen, was später mit
dem Goethe-Kult der Weimarer Zeit Gestalt annahm und weltweit Wirkung
erzielen sollte. Im Zusammen hang mit der Verehrung, die Goethe aus dem
Umfeld der Berliner Salons zuteil wurde, wäre eine weitere Facette des
Begriffes Kultbuch zu nennen. So schmückte Bettina Brentano von Arnim
ihre Verehrung des Weimarer Dichterfürsten fiktional aus und veröffentlichte
das dreibändige Skandal buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem
Denkmal (1835). Bettines Briefwechsel war nicht nur ein ›Kultbuch‹ in dem
Sinne, dass es von vielen Gleichgesinnten aufgenommen und weitergetragen
110