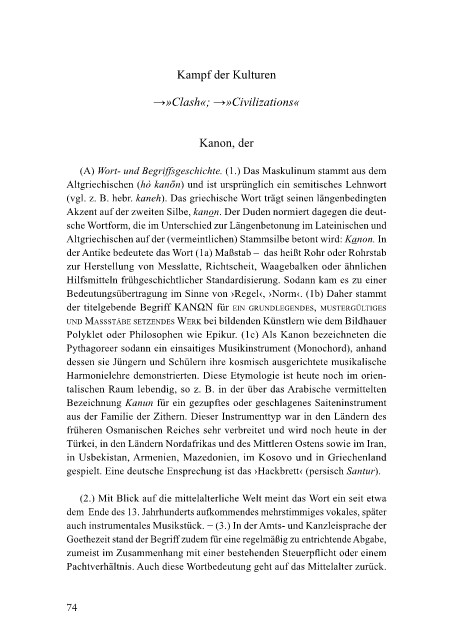Page 78 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 78
Kampf der Kulturen
→»Clash«; →»Civilizations«
Kanon, der
(A) Wort- und Begriffsgeschichte. (1.) Das Maskulinum stammt aus dem
Altgriechischen (hò kanōn) und ist ursprünglich ein semitisches Lehnwort
(vgl. z. B. hebr. kaneh). Das griechische Wort trägt seinen längenbedingten
Akzent auf der zweiten Silbe, kanon. Der Duden normiert dagegen die deut-
sche Wortform, die im Unterschied zur Längenbetonung im Lateinischen und
Altgriechischen auf der (vermeintlichen) Stammsilbe betont wird: Kanon. In
der Antike bedeutete das Wort (1a) Maßstab – das heißt Rohr oder Rohrstab
zur Herstellung von Messlatte, Richtscheit, Waagebalken oder ähnlichen
Hilfsmitteln frühgeschichtlicher Standardisierung. Sodann kam es zu einer
Bedeutungsübertragung im Sinne von ›Regel‹, ›Norm‹. (1b) Daher stammt
der titelgebende Begriff KANWN für EIn grundlEgEndEs, mustErgültIgEs
und massstäBE sEtzEndEs wErK bei bildenden Künstlern wie dem Bildhauer
Polyklet oder Philosophen wie Epikur. (1c) Als Kanon bezeichneten die
Pythagoreer sodann ein einsaitiges Musikinstrument (Monochord), anhand
dessen sie Jüngern und Schülern ihre kosmisch ausgerichtete musikalische
Harmonie lehre demonstrierten. Diese Etymologie ist heute noch im orien-
talischen Raum lebendig, so z. B. in der über das Arabische ver mittelten
Bezeichnung Kanun für ein gezupftes oder geschlagenes Saiteninstrument
aus der Familie der Zithern. Dieser Instrumenttyp war in den Ländern des
früheren Osmanischen Reiches sehr verbreitet und wird noch heute in der
Türkei, in den Län dern Nordafrikas und des Mittleren Ostens sowie im Iran,
in Usbekistan, Armenien, Mazedonien, im Kosovo und in Griechenland
gespielt. Eine deutsche Ensprechung ist das ›Hackbrett‹ (persisch Santur).
(2.) Mit Blick auf die mittelalterliche Welt meint das Wort ein seit etwa
dem Ende des 13. Jahrhunderts aufkommendes mehrstimmiges vokales, später
auch instrumentales Musikstück. - (3.) In der Amts- und Kanzleisprache der
Goethezeit stand der Begriff zudem für eine regelmäßig zu entrichtende Abgabe,
zumeist im Zusammenhang mit einer bestehenden Steuerpflicht oder einem
Pachtverhältnis. Auch diese Wortbedeutung geht auf das Mittelalter zurück.
74