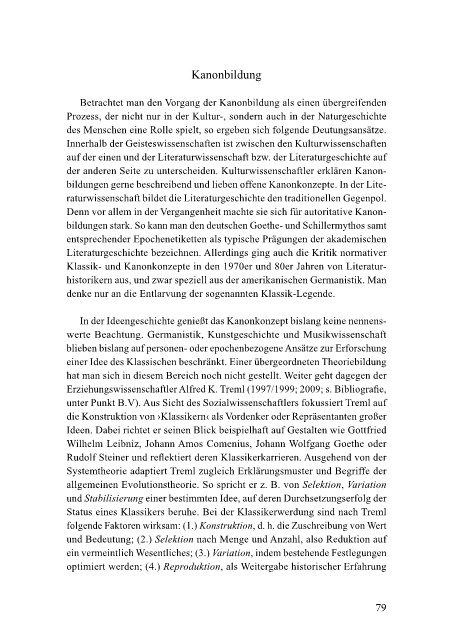Page 83 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 83
Kanonbildung
Betrachtet man den Vorgang der Kanonbildung als einen übergreifenden
Prozess, der nicht nur in der Kultur-, sondern auch in der Naturgeschichte
des Menschen eine Rolle spielt, so ergeben sich folgende Deutungs ansätze.
Innerhalb der Geisteswissenschaften ist zwischen den Kulturwissenschaften
auf der einen und der Literatur wissenschaft bzw. der Literaturgeschichte auf
der anderen Seite zu unterscheiden. Kultur wissenschaftler erklären Kanon-
bildungen gerne beschreibend und lieben offene Kanonkonzepte. In der Lite-
raturwissenschaft bildet die Literaturgeschichte den traditionellen Gegenpol.
Denn vor allem in der Vergangenheit machte sie sich für autoritative Kanon-
bildungen stark. So kann man den deutschen Goethe- und Schillermythos samt
entsprechender Epochenetiketten als typische Prägungen der akademischen
Literaturgeschichte bezeichnen. Allerdings ging auch die Kritik normativer
Klassik- und Kanonkonzepte in den 1970er und 80er Jahren von Literatur-
historikern aus, und zwar speziell aus der amerikanischen Germanistik. Man
denke nur an die Entlarvung der so genannten Klassik-Legende.
In der Ideengeschichte genießt das Kanonkonzept bislang keine nennens-
werte Beachtung. Germanistik, Kunstgeschichte und Musik wissenschaft
blieben bislang auf personen- oder epochenbezogene An sätze zur Erforschung
einer Idee des Klassischen beschränkt. Einer übergeord neten Theoriebildung
hat man sich in diesem Bereich noch nicht gestellt. Weiter geht dagegen der
Erziehungswissenschaftler Alfred K. Treml (1997/1999; 2009; s. Bibliografie,
unter Punkt B.V). Aus Sicht des Sozialwissenschaftlers fokussiert Treml auf
die Konstruktion von ›Klassikern‹ als Vordenker oder Repräsentanten großer
Ideen. Dabei richtet er seinen Blick beispielhaft auf Gestalten wie Gottfried
Wilhelm Leibniz, Johann Amos Comenius, Johann Wolfgang Goethe oder
Rudolf Steiner und reflektiert deren Klassikerkarrieren. Ausgehend von der
System theorie adaptiert Treml zugleich Erklärungsmuster und Begriffe der
allgemeinen Evolutionstheorie. So spricht er z. B. von Selektion, Variation
und Stabilisierung einer bestimmten Idee, auf deren Durchsetzungserfolg der
Status eines Klassikers beruhe. Bei der Klassikerwerdung sind nach Treml
folgende Faktoren wirksam: (1.) Konstruktion, d. h. die Zuschreibung von Wert
und Bedeutung; (2.) Selektion nach Menge und Anzahl, also Reduktion auf
ein vermeintlich Wesentliches; (3.) Variation, indem bestehende Festlegungen
optimiert werden; (4.) Reproduktion, als Weitergabe historischer Erfahrung
79