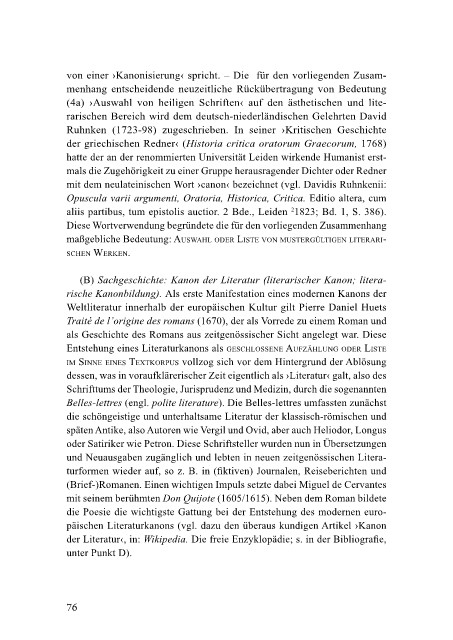Page 80 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 80
von einer ›Kanonisierung‹ spricht. – Die für den vorliegenden Zusam-
menhang entscheidende neuzeitliche Rückübertragung von Bedeutung
(4a) ›Auswahl von heiligen Schriften‹ auf den ästhetischen und lite-
rarischen Bereich wird dem deutsch-niederländischen Gelehrten David
Ruhnken (1723-98) zugeschrieben. In seiner ›Kritischen Geschichte
der griechischen Redner‹ (Historia critica oratorum Graecorum, 1768)
hatte der an der renommierten Universität Leiden wirkende Humanist erst-
mals die Zugehörigkeit zu einer Gruppe herausragender Dichter oder Redner
mit dem neulateinischen Wort ›canon‹ bezeichnet (vgl. Davidis Ruhnkenii:
Opuscula varii argumenti, Oratoria, Historica, Critica. Editio altera, cum
2
aliis partibus, tum epistolis auctior. 2 Bde., Leiden 1823; Bd. 1, S. 386).
Diese Wortverwendung begründete die für den vorliegenden Zusammenhang
maßgeb liche Bedeutung: auswahl odEr lIstE von mustErgültIgEn lItErarI-
schEn wErKEn.
(B) Sachgeschichte: Kanon der Literatur (literarischer Kanon; litera-
rische Kanonbildung). Als erste Manifestation eines modernen Kanons der
Weltliteratur innerhalb der europäischen Kultur gilt Pierre Daniel Huets
Traité de l’origine des romans (1670), der als Vorrede zu einem Roman und
als Geschichte des Romans aus zeitgenössischer Sicht angelegt war. Diese
Ent stehung eines Literaturkanons als gEschlossEnE aufzählung odEr lIstE
Im sInnE EInEs tExtKorPus vollzog sich vor dem Hintergrund der Ablösung
dessen, was in voraufklärerischer Zeit eigentlich als ›Literatur‹ galt, also des
Schrifttums der Theologie, Jurisprudenz und Medizin, durch die sogenannten
Belles-lettres (engl. polite literature). Die Belles-lettres umfassten zunächst
die schöngeistige und unterhaltsame Literatur der klassisch-römischen und
späten Antike, also Autoren wie Vergil und Ovid, aber auch Heliodor, Longus
oder Satiriker wie Petron. Diese Schriftsteller wurden nun in Übersetzungen
und Neuausgaben zugänglich und lebten in neuen zeitgenössischen Litera-
turformen wieder auf, so z. B. in (fiktiven) Journalen, Reiseberichten und
(Brief-)Romanen. Einen wichtigen Impuls setzte dabei Miguel de Cervantes
mit seinem berühmten Don Quijote (1605/1615). Neben dem Roman bildete
die Poesie die wichtigste Gattung bei der Entstehung des modernen euro-
päischen Litera turkanons (vgl. dazu den überaus kundigen Artikel ›Kanon
der Literatur‹, in: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie; s. in der Bibliografie,
unter Punkt D).
76