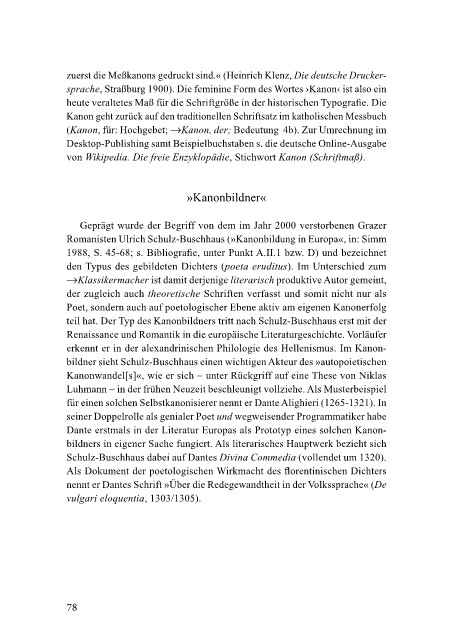Page 82 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 82
zuerst die Meßkanons gedruckt sind.« (Heinrich Klenz, Die deutsche Drucker-
sprache, Straßburg 1900). Die feminine Form des Wortes ›Kanon‹ ist also ein
heute veraltetes Maß für die Schriftgröße in der historischen Typografie. Die
Kanon geht zurück auf den traditionellen Schriftsatz im katholischen Messbuch
(Kanon, für: Hochgebet; →Kanon, der; Bedeutung 4b). Zur Umrechnung im
Desktop-Publishing samt Beispielbuchstaben s. die deutsche Online-Ausgabe
von Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, Stichwort Kanon (Schriftmaß).
»Kanonbildner«
Geprägt wurde der Begriff von dem im Jahr 2000 verstorbenen Grazer
Romanisten Ulrich Schulz-Buschhaus (»Kanonbildung in Europa«, in: Simm
1988, S. 45-68; s. Bibliografie, unter Punkt A.II.1 bzw. D) und bezeichnet
den Typus des gebildeten Dichters (poeta eruditus). Im Unterschied zum
→Klassikermacher ist damit derjenige literarisch produktive Autor gemeint,
der zugleich auch theoretische Schriften verfasst und somit nicht nur als
Poet, sondern auch auf poetologischer Ebene aktiv am eigenen Kanonerfolg
teil hat. Der Typ des Kanonbildners tritt nach Schulz-Buschhaus erst mit der
Renaissance und Romantik in die europäische Literaturgeschichte. Vorläufer
erkennt er in der alexandrinischen Philologie des Hellenismus. Im Kanon-
bildner sieht Schulz-Buschhaus einen wichtigen Akteur des »autopoietischen
Kanonwandel[s]«, wie er sich - unter Rückgriff auf eine These von Niklas
Luhmann - in der frühen Neuzeit beschleunigt vollziehe. Als Musterbeispiel
für einen solchen Selbstkanonisierer nennt er Dante Alighieri (1265-1321). In
seiner Doppelrolle als genialer Poet und wegweisender Programmatiker habe
Dante erstmals in der Literatur Europas als Prototyp eines solchen Kanon-
bildners in eigener Sache fungiert. Als literarisches Hauptwerk bezieht sich
Schulz-Buschhaus dabei auf Dantes Divina Commedia (vollendet um 1320).
Als Dokument der poetologischen Wirkmacht des florentinischen Dichters
nennt er Dantes Schrift »Über die Redegewandtheit in der Volkssprache« (De
vulgari eloquentia, 1303/1305).
78