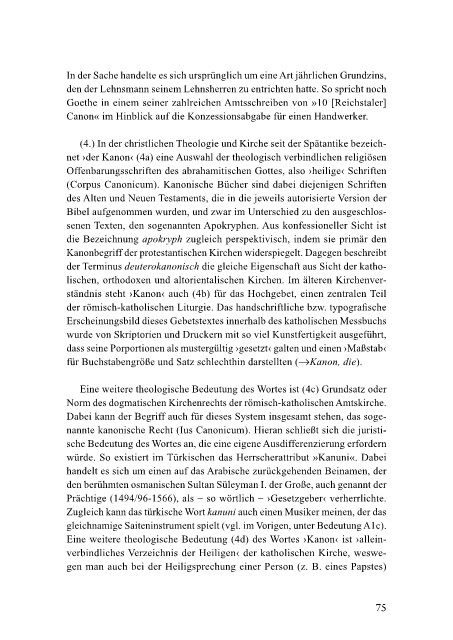Page 79 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 79
In der Sache handelte es sich ursprünglich um eine Art jährlichen Grundzins,
den der Lehnsmann seinem Lehnsherren zu entrichten hatte. So spricht noch
Goethe in einem seiner zahlreichen Amtsschreiben von »10 [Reichstaler]
Canon« im Hinblick auf die Konzessionsabgabe für einen Handwerker.
(4.) In der christlichen Theologie und Kirche seit der Spätantike bezeich-
net ›der Kanon‹ (4a) eine Auswahl der theologisch verbindlichen religiösen
Offenbarungs schriften des abrahamitischen Gottes, also ›heilige‹ Schriften
(Corpus Canonicum). Kanonische Bücher sind dabei diejenigen Schriften
des Alten und Neuen Testaments, die in die jeweils autorisierte Version der
Bibel aufgenommen wurden, und zwar im Unter schied zu den ausgeschlos-
senen Texten, den sogenannten Apokryphen. Aus konfessioneller Sicht ist
die Bezeichnung apokryph zugleich perspektivisch, indem sie primär den
Kanonbegriff der protestantischen Kirchen widerspiegelt. Dagegen beschreibt
der Terminus deuterokanonisch die gleiche Eigenschaft aus Sicht der katho-
lischen, orthodoxen und altorientalischen Kirchen. Im älteren Kirchenver-
ständnis steht ›Kanon‹ auch (4b) für das Hochgebet, einen zentralen Teil
der römisch-katholischen Liturgie. Das handschriftliche bzw. typografische
Erscheinungsbild dieses Gebetstextes innerhalb des katholischen Messbuchs
wurde von Skriptorien und Druckern mit so viel Kunstfertigkeit ausgeführt,
dass seine Porportionen als mustergültig ›gesetzt‹ galten und einen ›Maßstab‹
für Buchstabengröße und Satz schlechthin darstellten (→Kanon, die).
Eine weitere theologische Bedeutung des Wortes ist (4c) Grundsatz oder
Norm des dogmatischen Kirchenrechts der römisch-ka tholischen Amtskirche.
Dabei kann der Begriff auch für dieses System ins gesamt stehen, das soge-
nannte kanonische Recht (Ius Canonicum). Hieran schließt sich die juristi-
sche Bedeutung des Wortes an, die eine eigene Ausdifferenzierung erfordern
würde. So existiert im Türkischen das Herrscherattribut »Kanuni«. Dabei
handelt es sich um einen auf das Arabische zurückgehenden Beinamen, der
den berühmten osmanischen Sultan Süleyman I. der Große, auch genannt der
Prächtige (1494/96-1566), als - so wörtlich - ›Gesetzgeber‹ verherrlichte.
Zugleich kann das türkische Wort kanuni auch einen Musiker meinen, der das
gleichnamige Saiteninstrument spielt (vgl. im Vorigen, unter Bedeutung A1c).
Eine weitere theologische Bedeutung (4d) des Wortes ›Kanon‹ ist ›allein-
verbindliches Verzeichnis der Heiligen‹ der katholischen Kirche, weswe-
gen man auch bei der Heiligsprechung einer Person (z. B. eines Papstes)
75