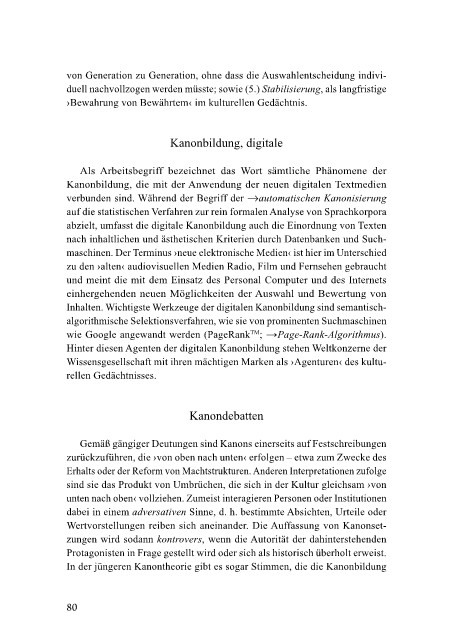Page 84 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 84
von Ge neration zu Generation, ohne dass die Auswahlentscheidung indivi-
duell nachvollzogen werden müsste; sowie (5.) Stabilisierung, als langfristige
›Bewahrung von Bewährtem‹ im kulturellen Gedächtnis.
Kanonbildung, digitale
Als Arbeitsbegriff bezeichnet das Wort sämtliche Phänomene der
Ka nonbildung, die mit der Anwendung der neuen digitalen Textmedien
verbunden sind. Während der Begriff der→automatischen Kanonisierung
auf die statistischen Verfahren zur rein formalen Analyse von Sprachkorpora
ab zielt, umfasst die digitale Kanonbildung auch die Einordnung von Texten
nach inhaltlichen und ästhetischen Kriterien durch Datenbanken und Such-
maschinen. Der Terminus ›neue elektronische Medien‹ ist hier im Unterschied
zu den ›alten‹ audiovisuellen Medien Radio, Film und Fernsehen gebraucht
und meint die mit dem Einsatz des Personal Computer und des Internets
einher gehenden neuen Möglichkeiten der Auswahl und Bewertung von
Inhalten. Wichtigste Werkzeuge der digitalen Kanonbildung sind semantisch-
algorithmische Selektionsverfahren, wie sie von prominenten Suchmaschinen
TM
wie Google angewandt werden (PageRank ; →Page-Rank-Algorithmus).
Hinter diesen Agenten der digitalen Kanonbildung stehen Weltkonzerne der
Wissensgesellschaft mit ihren mächtigen Marken als ›Agenturen‹ des kultu-
rellen Gedächtnisses.
Kanondebatten
Gemäß gängiger Deutungen sind Kanons einerseits auf Festschreibungen
zurück zuführen, die ›von oben nach unten‹ erfolgen – etwa zum Zwecke des
Erhalts oder der Reform von Machtstrukturen. Anderen Interpretationen zu folge
sind sie das Produkt von Umbrüchen, die sich in der Kultur gleichsam ›von
unten nach oben‹ vollziehen. Zumeist interagieren Personen oder Institutionen
dabei in einem adversativen Sinne, d. h. bestimmte Absichten, Urteile oder
Wertvorstellungen reiben sich aneinander. Die Auffassung von Kanonset-
zungen wird sodann kontrovers, wenn die Autorität der dahin terstehenden
Protagonisten in Frage gestellt wird oder sich als historisch über holt erweist.
In der jüngeren Kanontheorie gibt es sogar Stimmen, die die Kanon bildung
80