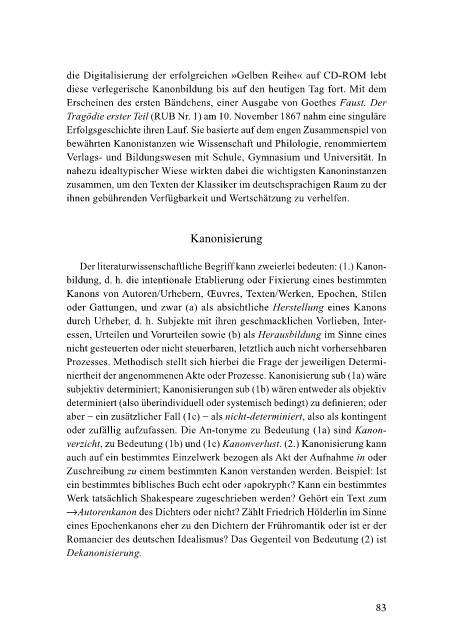Page 87 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 87
die Digitali sierung der erfolgreichen »Gelben Reihe« auf CD-ROM lebt
diese verlegerische Kanonbildung bis auf den heutigen Tag fort. Mit dem
Erscheinen des ersten Bändchens, einer Ausgabe von Goethes Faust. Der
Tragödie erster Teil (RUB Nr. 1) am 10. November 1867 nahm eine singuläre
Erfolgs geschichte ihren Lauf. Sie basierte auf dem engen Zusammenspiel von
bewährten Kanonistanzen wie Wissenschaft und Philologie, renommiertem
Verlags- und Bildungs wesen mit Schule, Gymnasium und Universität. In
nahezu idealtypischer Wiese wirkten dabei die wichtigsten Kanoninstanzen
zusammen, um den Texten der Klassiker im deutschsprachigen Raum zu der
ihnen gebührenden Verfügbarkeit und Wertschätzung zu verhelfen.
Kanonisierung
Der literaturwissenschaftliche Begriff kann zweierlei bedeuten: (1.) Kanon-
bildung, d. h. die intentionale Etablierung oder Fixierung eines bestimmten
Kanons von Autoren/Urhebern, Œuvres, Texten/Werken, Epochen, Stilen
oder Gattungen, und zwar (a) als absichtliche Herstellung eines Kanons
durch Urheber, d. h. Subjekte mit ihren geschmacklichen Vorlieben, Inter-
essen, Urteilen und Vorurteilen sowie (b) als Herausbildung im Sinne eines
nicht gesteuerten oder nicht steuerbaren, letztlich auch nicht vorhersehbaren
Prozesses. Methodisch stellt sich hierbei die Frage der jeweiligen Determi-
niertheit der angenommenen Akte oder Prozesse. Kanonisierung sub (1a) wäre
subjektiv determiniert; Kanoni sierungen sub (1b) wären entweder als objektiv
determiniert (also über individuell oder systemisch bedingt) zu definieren; oder
aber − ein zusätzlicher Fall (1c) − als nicht-determiniert, also als kontingent
oder zufällig aufzufassen. Die An-tonyme zu Bedeutung (1a) sind Kanon-
verzicht, zu Bedeutung (1b) und (1c) Kanonverlust. (2.) Kanonisierung kann
auch auf ein bestimmtes Einzel werk bezogen als Akt der Aufnahme in oder
Zuschreibung zu einem bestimmten Kanon verstanden werden. Beispiel: Ist
ein bestimmtes biblisches Buch echt oder ›apokryph‹? Kann ein bestimmtes
Werk tatsächlich Shakespeare zugeschrieben werden? Gehört ein Text zum
→Autorenkanon des Dichters oder nicht? Zählt Friedrich Hölderlin im Sinne
eines Epochenkanons eher zu den Dichtern der Frühromantik oder ist er der
Romancier des deutschen Idealismus? Das Gegenteil von Bedeutung (2) ist
Dekanonisierung.
83