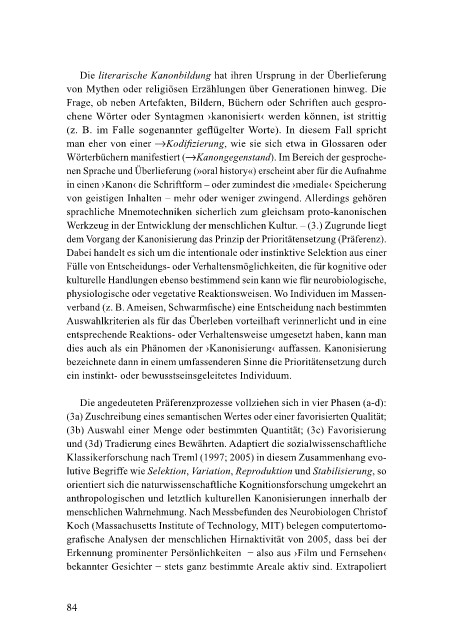Page 88 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 88
Die literarische Kanonbildung hat ihren Ursprung in der Überlieferung
von Mythen oder religiösen Erzählungen über Generationen hinweg. Die
Frage, ob neben Artefakten, Bildern, Büchern oder Schriften auch gespro-
chene Wörter oder Syntagmen ›kanonisiert‹ werden können, ist strittig
(z. B. im Falle sogenannter geflügelter Worte). In diesem Fall spricht
man eher von einer →Kodifizierung, wie sie sich etwa in Glossaren oder
Wörterbüchern mani festiert (→Kanongegenstand). Im Bereich der gesproche-
nen Sprache und Überlieferung (»oral history«) erscheint aber für die Aufnahme
in einen ›Kanon‹ die Schriftform – oder zumindest die ›mediale‹ Speicherung
von geistigen Inhalten – mehr oder weniger zwingend. Allerdings gehören
sprachliche Mnemo techniken sicherlich zum gleichsam proto-kanonischen
Werkzeug in der Ent wicklung der menschlichen Kultur. – (3.) Zugrunde liegt
dem Vorgang der Kanonisierung das Prinzip der Prioritätensetzung (Präferenz).
Dabei handelt es sich um die intentionale oder instinktive Selektion aus einer
Fülle von Ent scheidungs- oder Verhaltensmöglichkeiten, die für kognitive oder
kulturelle Handlungen ebenso bestimmend sein kann wie für neurobiologische,
physio logische oder vegetative Reaktionsweisen. Wo Individuen im Massen-
verband (z. B. Ameisen, Schwarmfische) eine Entscheidung nach bestimmten
Auswahl kriterien als für das Überleben vorteilhaft verinnerlicht und in eine
entsprechende Reaktions- oder Verhaltensweise umgesetzt haben, kann man
dies auch als ein Phänomen der ›Kanonisierung‹ auffassen. Kanonisierung
be zeichnete dann in einem umfassenderen Sinne die Prioritätensetzung durch
ein instinkt- oder bewusstseinsgeleitetes Individuum.
Die angedeuteten Präferenzprozesse vollziehen sich in vier Phasen (a-d):
(3a) Zuschreibung eines semantischen Wertes oder einer favorisierten Qualität;
(3b) Auswahl einer Menge oder bestimmten Quantität; (3c) Favorisierung
und (3d) Tradierung eines Bewährten. Adaptiert die sozialwissenschaftliche
Klassiker forschung nach Treml (1997; 2005) in diesem Zusammenhang evo-
lutive Begriffe wie Selektion, Variation, Reproduktion und Stabilisierung, so
orientiert sich die naturwissen schaftliche Kognitionsforschung umgekehrt an
anthropologischen und letztlich kulturellen Kanonisierungen innerhalb der
menschlichen Wahrnehmung. Nach Messbefunden des Neurobiologen Christof
Koch (Massachusetts Institute of Technology, MIT) belegen computertomo-
grafische Analysen der menschlichen Hirnaktivität von 2005, dass bei der
Erkennung prominenter Persönlichkeiten − also aus ›Film und Fernsehen‹
bekannter Gesichter − stets ganz bestimmte Areale aktiv sind. Extrapoliert
84