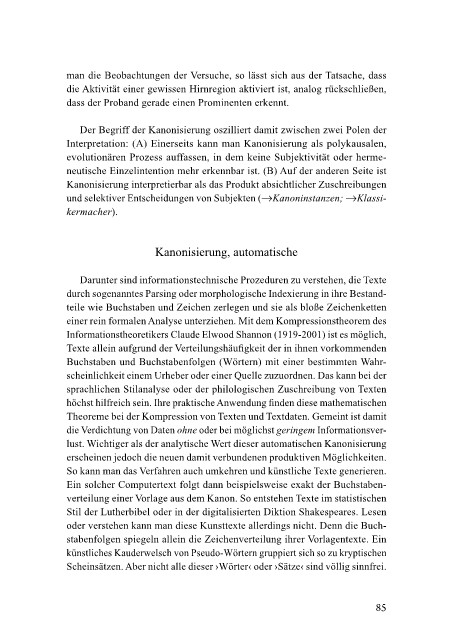Page 89 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 89
man die Beobachtungen der Ver suche, so lässt sich aus der Tatsache, dass
die Aktivität einer gewissen Hirnregion aktiviert ist, analog rückschließen,
dass der Proband gerade einen Promi nenten erkennt.
Der Begriff der Kanonisierung oszilliert damit zwischen zwei Polen der
Interpretation: (A) Einerseits kann man Kanonisierung als polykausalen,
evo lutionären Prozess auffassen, in dem keine Subjektivität oder herme-
neutische Einzelintention mehr erkennbar ist. (B) Auf der anderen Seite ist
Kanoni sierung interpretierbar als das Produkt absichtlicher Zuschreibungen
und se lektiver Entscheidungen von Subjekten (→Kanoninstanzen;→Klassi-
kermacher).
Kanonisierung, automatische
Darunter sind informationstechnische Prozeduren zu verstehen, die Texte
durch sogenanntes Parsing oder morphologische Indexierung in ihre Bestand-
teile wie Buchstaben und Zeichen zerlegen und sie als bloße Zeichenketten
einer rein formalen Analyse unterziehen. Mit dem Kompressionstheorem des
Informations theoretikers Claude Elwood Shannon (1919-2001) ist es möglich,
Texte allein aufgrund der Verteilungshäufigkeit der in ihnen vorkommenden
Buchstaben und Buchstaben folgen (Wörtern) mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit einem Urheber oder einer Quelle zuzuordnen. Das kann bei der
sprachlichen Stilanalyse oder der philologischen Zu schreibung von Texten
höchst hilfreich sein. Ihre praktische Anwendung finden diese mathematischen
Theoreme bei der Kompression von Texten und Textdaten. Gemeint ist damit
die Verdichtung von Daten ohne oder bei möglichst geringem Informationsver-
lust. Wichtiger als der analytische Wert dieser automatischen Kanonisierung
erscheinen jedoch die neuen damit verbundenen produktiven Möglichkeiten.
So kann man das Verfahren auch umkehren und künstliche Texte generieren.
Ein solcher Computertext folgt dann beispielsweise exakt der Buchstaben-
verteilung einer Vorlage aus dem Kanon. So entstehen Texte im statistischen
Stil der Lutherbibel oder in der digitalisierten Diktion Shakespeares. Lesen
oder verstehen kann man diese Kunsttexte allerdings nicht. Denn die Buch-
stabenfolgen spiegeln allein die Zeichenverteilung ihrer Vorlagen texte. Ein
künstliches Kauderwelsch von Pseudo-Wörtern gruppiert sich so zu kryptischen
Scheinsätzen. Aber nicht alle dieser ›Wörter‹ oder ›Sätze‹ sind völlig sinnfrei.
85