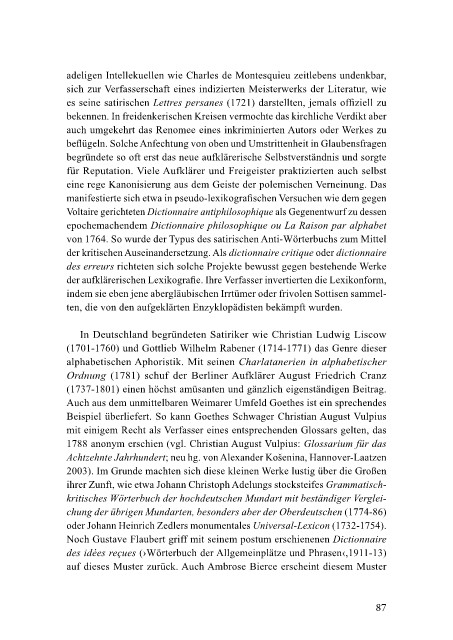Page 91 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 91
adeligen Intellekuellen wie Charles de Montesquieu zeitlebens undenkbar,
sich zur Verfasserschaft eines indizierten Meister werks der Literatur, wie
es seine satirischen Lettres persanes (1721) darstellten, jemals offiziell zu
bekennen. In freidenkerischen Kreisen vermochte das kirchliche Verdikt aber
auch umgekehrt das Renomee eines inkriminierten Autors oder Werkes zu
beflügeln. Solche Anfechtung von oben und Umstrit tenheit in Glaubensfragen
begründete so oft erst das neue aufklärerische Selbstverständnis und sorgte
für Reputation. Viele Aufklärer und Frei geister praktizierten auch selbst
eine rege Kanonisierung aus dem Geiste der polemischen Verneinung. Das
manifestierte sich etwa in pseudo -lexikografischen Versuchen wie dem gegen
Voltaire gerichteten Dictionnaire antiphilosophique als Gegenentwurf zu dessen
epochemachendem Dictionnaire philosophique ou La Raison par alphabet
von 1764. So wurde der Typus des satirischen Anti-Wörterbuchs zum Mittel
der kritischen Auseinandersetzung. Als dictionnaire critique oder dictionnaire
des erreurs richteten sich solche Projekte bewusst gegen bestehende Werke
der aufklärerischen Lexikografie. Ihre Verfasser invertierten die Lexikonform,
indem sie eben jene abergläubischen Irrtümer oder frivolen Sottisen sammel-
ten, die von den aufgeklärten Enzyklopädisten bekämpft wurden.
In Deutschland begründeten Satiriker wie Christian Ludwig Liscow
(1701-1760) und Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771) das Genre dieser
alphabetischen Aphoristik. Mit seinen Charlatanerien in alphabetischer
Ordnung (1781) schuf der Berliner Aufklärer August Friedrich Cranz
(1737-1801) einen höchst amüsanten und gänzlich eigenständigen Beitrag.
Auch aus dem unmittelbaren Weimarer Umfeld Goethes ist ein sprechendes
Beispiel über liefert. So kann Goethes Schwager Christian August Vulpius
mit einigem Recht als Verfasser eines entsprechenden Glossars gelten, das
1788 anonym erschien (vgl. Christian August Vulpius: Glossarium für das
Achtzehnte Jahrhundert; neu hg. von Alexander Košenina, Hannover-Laatzen
2003). Im Grunde machten sich diese kleinen Werke lustig über die Großen
ihrer Zunft, wie etwa Johann Christoph Adelungs stocksteifes Grammatisch-
kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart mit beständiger Verglei-
chung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen (1774-86)
oder Johann Heinrich Zedlers monumentales Universal-Lexicon (1732-1754).
Noch Gustave Flaubert griff mit seinem postum erschienenen Dictionnaire
des idées reçues (›Wörterbuch der Allgemeinplätze und Phrasen‹,1911-13)
auf dieses Muster zurück. Auch Ambrose Bierce erscheint diesem Muster
87