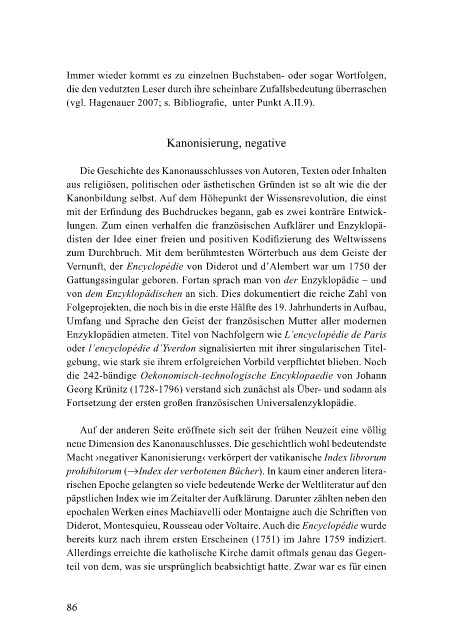Page 90 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 90
Immer wieder kommt es zu einzelnen Buchstaben- oder sogar Wortfolgen,
die den vedutzten Leser durch ihre scheinbare Zufallsbedeutung überraschen
(vgl. Hagenauer 2007; s. Bibliografie, unter Punkt A.II.9).
Kanonisierung, negative
Die Geschichte des Kanonausschlusses von Autoren, Texten oder Inhalten
aus re ligiösen, politischen oder ästhetischen Gründen ist so alt wie die der
Kanon bildung selbst. Auf dem Höhepunkt der Wissensrevolution, die einst
mit der Erfindung des Buchdruckes begann, gab es zwei konträre Entwick-
lungen. Zum einen verhalfen die französischen Aufklärer und Enzyklopä-
disten der Idee einer freien und positiven Kodifizierung des Weltwissens
zum Durchbruch. Mit dem berühmtesten Wörterbuch aus dem Geiste der
Vernunft, der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert war um 1750 der
Gattungssingular geboren. Fortan sprach man von der Enzyklopädie – und
von dem Enzyklopädischen an sich. Dies do kumentiert die reiche Zahl von
Folgeprojekten, die noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in Aufbau,
Umfang und Sprache den Geist der französischen Mutter aller modernen
Enzyklopädien atmeten. Titel von Nachfolgern wie L’encyclopédie de Paris
oder l’encyclopédie d’Yverdon signalisierten mit ihrer singularischen Titel-
gebung, wie stark sie ihrem erfolgreichen Vorbild verpflichtet blieben. Noch
die 242-bändige Oekonomisch-technologische Encyklopaedie von Johann
Georg Krünitz (1728-1796) verstand sich zunächst als Über- und sodann als
Fortsetzung der ersten großen französischen Universalenzyklopädie.
Auf der anderen Seite eröffnete sich seit der frühen Neuzeit eine völlig
neue Dimension des Kanonauschlusses. Die geschichtlich wohl bedeutendste
Macht ›negativer Kanonisierung‹ verkörpert der vatikanische Index librorum
prohibitorum (→Index der verbotenen Bücher). In kaum einer anderen litera-
rischen Epoche gelangten so viele bedeutende Werke der Weltliteratur auf den
päpstlichen Index wie im Zeitalter der Aufklärung. Darunter zählten neben den
epochalen Werken eines Machiavelli oder Montaigne auch die Schriften von
Diderot, Montesquieu, Rousseau oder Voltaire. Auch die Encyclopédie wurde
bereits kurz nach ihrem ersten Erscheinen (1751) im Jahre 1759 indiziert.
Allerdings erreichte die katholische Kirche damit oftmals genau das Gegen-
teil von dem, was sie ursprünglich beabsichtigt hatte. Zwar war es für einen
86