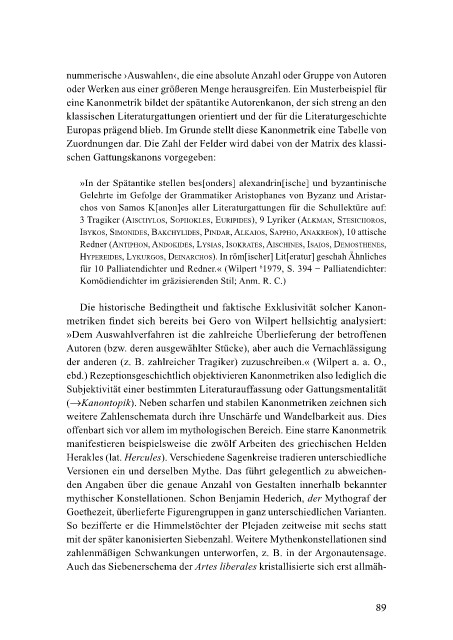Page 93 - Robert Charlier: Google statt Goethe?
P. 93
nummerische ›Auswahlen‹, die eine absolute Anzahl oder Gruppe von Autoren
oder Werken aus einer größeren Menge herausgreifen. Ein Musterbeispiel für
eine Kanonmetrik bildet der spätantike Autorenkanon, der sich streng an den
klassischen Literaturgattungen orientiert und der für die Literaturgeschichte
Europas prägend blieb. Im Grunde stellt diese Kanonmetrik eine Tabelle von
Zuordnungen dar. Die Zahl der Felder wird dabei von der Matrix des klassi-
schen Gattungskanons vorgegeben:
»In der Spätantike stellen bes[onders] alexandrin[ische] und byzantinische
Gelehrte im Gefolge der Grammatiker Aristophanes von Byzanz und Aristar-
chos von Samos K[anon]es aller Literaturgattungen für die Schullektüre auf:
3 Tragiker (aIschylos, soPhoKlEs, EurIPIdEs), 9 Lyriker (alKman, stEsIchoros,
IByKos, sImonIdEs, BaKchylIdEs, PIndar, alKaIos, saPPho, anaKrEon), 10 attische
Redner (antIPhon, andoKIdEs, lysIas, IsoKratEs, aIschInEs, IsaIos, dEmosthEnEs,
hyPErEIdEs, lyKurgos, dEInarchos). In röm[ischer] Lit[eratur] geschah Ähnliches
für 10 Palliatendichter und Redner.« (Wilpert 1979, S. 394 − Palliatendichter:
6
Komödiendichter im gräzisierenden Stil; Anm. R. C.)
Die historische Bedingtheit und faktische Exklusivität solcher Kanon-
metriken findet sich bereits bei Gero von Wilpert hellsichtig analysiert:
»Dem Auswahl verfahren ist die zahlreiche Überlieferung der betroffenen
Autoren (bzw. deren ausgewählter Stücke), aber auch die Vernachlässigung
der anderen (z. B. zahl reicher Tragiker) zuzuschreiben.« (Wilpert a. a. O.,
ebd.) Rezeptions geschichtlich objektivieren Kanonmetriken also lediglich die
Subjektivität einer bestimmten Literaturauffassung oder Gattungsmentalität
(→Kanontopik). Neben scharfen und stabilen Kanonmetriken zeichnen sich
weitere Zahlenschemata durch ihre Unschärfe und Wandelbarkeit aus. Dies
offenbart sich vor allem im mythologischen Bereich. Eine starre Kanonmetrik
mani festieren beispielsweise die zwölf Arbeiten des griechischen Helden
Herakles (lat. Hercules). Verschiedene Sagenkreise tradieren unterschiedli che
Versionen ein und derselben Mythe. Das führt gelegentlich zu abweichen-
den Angaben über die genaue Anzahl von Gestalten innerhalb bekannter
mythischer Konstellationen. Schon Benjamin Hederich, der Mytho graf der
Goethezeit, überlieferte Figurengruppen in ganz unterschiedlichen Varianten.
So bezifferte er die Himmelstöchter der Plejaden zeitweise mit sechs statt
mit der später kanonisierten Siebenzahl. Weitere Mythen konstellationen sind
zahlenmäßigen Schwankungen unterworfen, z. B. in der Argonautensage.
Auch das Siebenerschema der Artes liberales kristallisierte sich erst allmäh-
89