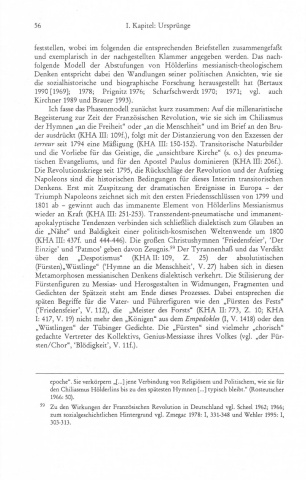Page 58 - Robert Charlier: Heros und Messias (1999)
P. 58
56 I. Kapitel: Ursprünge
feststellen, wobei im folgenden die entsprechenden Briefstellen zusammengefaßt
und exemplarisch in der nachgestellten Klammer angegeben werden. Das nach
folgende Modell der Abstufungen von Hölderlins messianisch-theologischem
Denken entspricht dabei den Wandlungen seiner politischen Ansichten, wie sie
die sozialhistorische und biographische Forschung herausgestellt hat (Bertaux
1990 [1969]; 1978; Prignitz 1976; Scharfschwerdt 1970; 1971; vgl. auch
Kirchner 1989 und Brauer 1993).
Ich fasse das Phasenmodell zunächst kurz zusammen: Auf die millenaristische
Begeisterung zur Zeit der Französischen Revolution, wie sie sich im Chiliasmus
der Hymnen „an die Freiheit“ oder „an die Menschheit“ und im Brief an den Bru
der ausdrückt (KHA III: 109f.), folgt mit der Distanzierung von den Exzessen der
terreur seit 1794 eine Mäßigung (KHA III: 150-152). Transitorische Naturbilder
und die Vorliebe für das Geistige, die „unsichtbare Kirche“ (s. o.) des pneuma
tischen Evangeliums, und für den Apostel Paulus dominieren (KHA III: 206f.).
Die Revolutionskriege seit 1795, die Rückschläge der Revolution und der Aufstieg
Napoleons sind die historischen Bedingungen für dieses Interim transitorischen
Denkens. Erst mit Zuspitzung der dramatischen Ereignisse in Europa - der
Triumph Napoleons zeichnet sich mit den ersten Friedensschlüssen von 1799 und
1801 ab - gewinnt auch das immanente Element von Hölderlins Messianismus
wieder an Kraft (KHA III: 251-253). Transzendent-pneumatische und immanent
apokalyptische Tendenzen verbinden sich schließlich dialektisch zum Glauben an
die „Nähe“ und Baldigkeit einer politisch-kosmischen Weltenwende um 1800
(KHA III: 437f. und 444-446). Die großen Christushymnen ‘Friedensfeier’, ‘Der
Einzige’ und ‘Patmos’ geben davon Zeugnis.59 Der Tyrannenhaß und das Verdikt
über den „Despotismus“ (KHA II: 109, Z. 25) der absolutistischen
(Fürsten)„Wüstlinge“ (‘Hymne an die Menschheit’, V. 27) haben sich in diesen
Metamorphosen messianischen Denkens dialektisch verkehrt. Die Stilisierung der
Fürstenfiguren zu Messias- und Herosgestalten in Widmungen, Fragmenten und
Gedichten der Spätzeit steht am Ende dieses Prozesses. Dabei entsprechen die
späten Begriffe für die Vater- und Führerfiguren wie den „Fürsten des Fests“
(‘Friedensfeier’, V. 112), die „Meister des Forsts“ (KHA II: 773, Z. 10; KHA
I: 417, V. 19) nicht mehr den „Königen“ aus dem Empedokles (I, V. 1418) oder den
„Wüstlingen“ der Tübinger Gedichte. Die „Fürsten“ sind vielmehr „chorisch“
gedachte Vertreter des Kollektivs, Genius-Messiasse ihres Volkes (vgl. „der Für
sten/Chor“, ‘Blödigkeit’, V. llf.).
epoche“. Sie verkörpern „[...] jene Verbindung von Religiösem und Politischem, wie sie für
den Chiliasmus Hölderlins bis zu den spätesten Hymnen [...] typisch bleibt.“ (Rosteutscher
1966: 50).
59 Zu den Wirkungen der Französischen Revolution in Deutschland vgl. Scheel 1962; 1966;
zum sozialgeschichtlichen Hintergrund vgl. Zmegac 1978: I, 331-348 und Wehler 1995: I,
303-313.