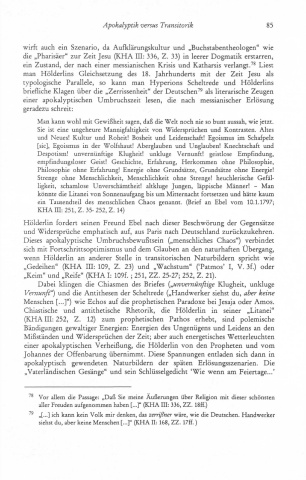Page 87 - Robert Charlier: Heros und Messias (1999)
P. 87
Apokalyptik versus Transitorik 85
wirft auch ein Szenario, da Aufklärungskultur und „Buchstabentheologen“ wie
die „Pharisäer“ zur Zeit Jesu (KHA III: 336, Z. 33) in leerer Dogmatik erstarren,
ein Zustand, der nach einer messianischen Krisis und Katharsis verlangt.78 Liest
man Hölderlins Gleichsetzung des 18. Jahrhunderts mit der Zeit Jesu als
typologische Parallele, so kann man Hyperions Scheltrede und Hölderlins
briefliche Klagen über die „Zerrissenheit“ der Deutschen79 als literarische Zeugen
einer apokalyptischen Umbruchszeit lesen, die nach messianischer Erlösung
geradezu schreit:
Man kann wohl mit Gewißheit sagen, daß die Welt noch nie so bunt aussah, wie jetzt.
Sie ist eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Widersprüchen und Kontrasten. Altes
und Neues! Kultur und Roheit! Bosheit und Leidenschaft! Egoismus im Schafpelz
[sic], Egoismus in der Wolfshaut! Aberglauben und Unglauben! Knechtschaft und
Despotism! unvernünftige Klugheit! unkluge Vernunft! geistlose Empfindung,
empfindungsloser Geist! Geschichte, Erfahrung, Herkommen ohne Philosophie,
Philosophie ohne Erfahrung! Energie ohne Grundsätze, Grundsätze ohne Energie!
Strenge ohne Menschlichkeit, Menschlichkeit ohne Strenge! heuchlerische Gefäl
ligkeit, schamlose Unverschämtheit! altkluge Jungen, läppische Männer! - Man
könnte die Litanei von Sonnenaufgang bis um Mitternacht fortsetzen und hätte kaum
ein Tausendteil des menschlichen Chaos genannt. (Brief an Ebel vom 10.1.1797;
KHA IH: 251, Z. 35- 252, Z. 14)
Hölderlin fordert seinen Freund Ebel nach dieser Beschwörung der Gegensätze
und Widersprüche emphatisch auf, aus Paris nach Deutschland zurückzukehren.
Dieses apokalyptische Umbruchsbewußtsein („menschliches Chaos“) verbindet
sich mit Fortschrittsoptimismus und dem Glauben an den naturhaften Übergang,
wenn Hölderlin an anderer Stelle in transitorischen Naturbildern spricht wie
„Gedeihen“ (KHA III: 109, Z. 23) und „Wachstum“ (T am os’ I, V. 3f.) oder
„Keim“ und „Reife“ (KHA I: 109f. ; 251, ZZ. 25-27; 252, Z. 21).
Dabei klingen die Chiasmen des Briefes („unvernünftige Klugheit, unkluge
Vernunft“) und die Antithesen der Scheltrede („Handwerker siehst du, aber keine
Menschen [...]“) wie Echos auf die prophetischen Paradoxe bei Jesaja oder Arnos.
Chiastische und antithetische Rhetorik, die Hölderlin in seiner „Litanei“
(KHA III: 252, Z. 12) zum prophetischen Pathos erhebt, sind polemische
Bändigungen gewaltiger Energien: Energien des Ungenügens und Leidens an den
Mißständen und Widersprüchen der Zeit; aber auch energetisches Wetterleuchten
einer apokalyptischen Verheißung, die Hölderlin von den Propheten und vom
Johannes der Offenbarung übernimmt. Diese Spannungen entladen sich dann in
apokalyptisch gewendeten Naturbildern der späten Erlösungsszenarien. Die
„Vaterländischen Gesänge“ und sein Schlüsselgedicht ‘Wie wenn am Feiertage...’
78 Vor allem die Passage: „Daß Sie meine Äußerungen über Religion mit dieser schönsten
aller Freuden aufgenommen haben [...]“ (KHA III: 336, ZZ. 18ff.)
79 „[...] ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker
siehst du, aber keine Menschen [...]“ (KHA II: 168, ZZ. 17ff.)