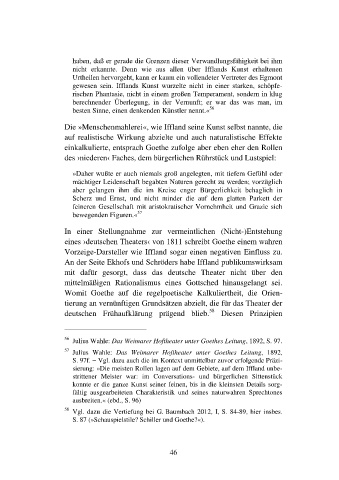Page 48 - Robert Charlier: Goethe und August Wilhelm Iffland (1779-1814)
P. 48
haben, daß er gerade die Grenzen dieser Verwandlungsfähigkeit bei ihm
nicht erkannte. Denn wie aus allen über Ifflands Kunst erhaltenen
Urtheilen hervorgeht, kann er kaum ein vollendeter Vertreter des Egmont
gewesen sein. Ifflands Kunst wurzelte nicht in einer starken, schöpfe-
rischen Phantasie, nicht in einem großen Temperament, sondern in klug
berechnender Überlegung, in der Vernunft; er war das was man, im
56
besten Sinne, einen denkenden Künstler nennt.«
Die »Menschenmahlerei«, wie Iffland seine Kunst selbst nannte, die
auf realistische Wirkung abzielte und auch naturalistische Effekte
einkalkulierte, entsprach Goethe zufolge aber eben eher den Rollen
des ›niederen‹ Faches, dem bürgerlichen Rührstück und Lustspiel:
»Daher wußte er auch niemals groß angelegten, mit tiefem Gefühl oder
mächtiger Leidenschaft begabten Naturen gerecht zu werden; vorzüglich
aber gelangen ihm die im Kreise enger Bürgerlichkeit behaglich in
Scherz und Ernst, und nicht minder die auf dem glatten Parkett der
feineren Gesellschaft mit aristokratischer Vornehmheit und Grazie sich
57
bewegenden Figuren.«
In einer Stellungnahme zur vermeintlichen (Nicht-)Entstehung
eines ›deutschen Theaters‹ von 1811 schreibt Goethe einem wahren
Vorzeige-Darsteller wie Iffland sogar einen negativen Einfluss zu.
An der Seite Ekhofs und Schröders habe Iffland publikumswirksam
mit dafür gesorgt, dass das deutsche Theater nicht über den
mittelmäßigen Rationalismus eines Gottsched hinausgelangt sei.
Womit Goethe auf die regelpoetische Kalkuliertheit, die Orien-
tierung an vernünftigen Grundsätzen abzielt, die für das Theater der
58
deutschen Frühaufklärung prägend blieb. Diesen Prinzipien
56
Julius Wahle: Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung, 1892, S. 97.
57
Julius Wahle: Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung, 1892,
S. 97f. Vgl. dazu auch die im Kontext unmittelbar zuvor erfolgende Präzi-
sierung: »Die meisten Rollen lagen auf dem Gebiete, auf dem Iffland unbe-
strittener Meister war: im Conversations- und bürgerlichen Sittenstück
konnte er die ganze Kunst seiner feinen, bis in die kleinsten Details sorg-
fältig ausgearbeiteten Charakteristik und seines naturwahren Sprechtones
ausbreiten.« (ebd., S. 96)
58
Vgl. dazu die Vertiefung bei G. Baumbach 2012, I, S. 84-89, hier insbes.
S. 87 (»Schauspielstile? Schiller und Goethe?«).
46